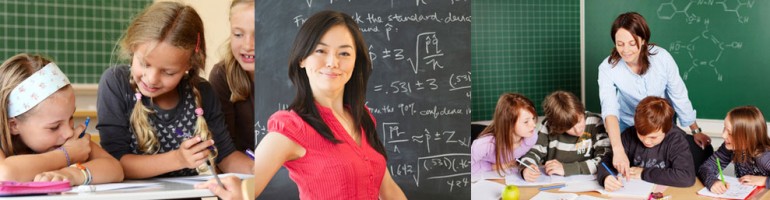Die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty durch einen 18-jährigen Islamisten hat auch hierzulande die Frage aufgeworfen, wie groß in unseren Schulen der Einfluss des politischen Islam gediehen ist. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger sprach davon, dass in Schulen mit hohem Anteil muslimischer Schüler die Lehrer unter Druck gesetzt würden, Themen wie Nahostkonflikt oder Israel im Unterricht zu vermeiden. Die Schere im Kopf führe sogar dazu, dass Lehrkräfte Filme wie „Schindlers Liste“ nicht mehr zeigten.
Die Schule ist eine Institution, in der sich gesellschaftlichen Verwerfungen hautnah abbilden. Alle Konflikte, die in der Gesellschaft ausgefochten werden, landen über kurz oder lang auch in den Klassenzimmern. Deshalb wären die Kultusminister gut beraten, die Spielregeln, die in der Schule gelten sollen, klarer und deutlicher als bisher zu definieren. Die Schulgesetze reichen dafür offensichtlich nicht mehr aus. Ich habe mich nie gescheut, von einer Leitkultur zu sprechen, die als Leitplanke für innerschulisches Handeln dienen könnte. Der Begriff Leitkultur wurde 1996 von dem deutsch-syrischen Politologen Bassam Tibi geprägt. Er zählte dazu die Werte der „kulturellen Moderne“ wie Demokratie, Laizismus, Aufklärung, Menschenrechte und Zivilgesellschaft. Der in den letzten Jahren ausgetragene politische Streit um den Begriff der „deutschen“ Leitkultur war überflüssig, weil die von Tibi formulierten Werte für jedes Staatswesen des Westens gelten, das den Anspruch erhebt, demokratisch zu sein. Wie könnte eine Leitkultur für die Schule aussehen?
Wichtigstes Prinzip der demokratischen Schule ist ihre Neutralität. Sie ist nötig, weil sich im Kosmos Schule Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, sozialer Schichtzugehörigkeit, Lebensstile, religiöser und weltanschaulicher Prägung begegnen. Ein friedliches Zusammenleben aller Schüler – wichtigste Voraussetzung für erfolgreichen Unterricht – ist nur gewährleistet, wenn das Trennende, die Identitätsunterschiede, ausgeblendet werden. Dies gelingt nur in einer Kultur der Toleranz, durch Akzeptanz des Andersseins. Daraus folgt schlüssig, dass politische und religiöse Einflussnahmen – gleichgültig, von welcher Seite sie kommen – in der Schule nicht gestattet werden können. Deutschland kennt nicht die strenge französische Laizität. Im Religionsunterricht geben wir den Konfessionen Raum, ihren Glauben zu präsentieren. Im Unterricht aller anderen Fächer muss hingegen strikte weltanschauliche und religiöse Neutralität herrschen, wenn man nicht riskieren will, dass die heftigen Affekte, die sich oft an „die letzten Dinge“ heften, den Bildungsprozess beschädigen. Vor dem Satz des Pythagoras oder Lessings Ringparabel sind alle Schüler gleich. Hier zählen nur Bildungswille und Auffassungsgabe. Die Integrationsleistung unserer Schulen ist gerade deshalb so hoch, weil das Wissen, das sie vermitteln, alle Schüler einander gleich macht.
Ein leidiges Problem an unseren Schulen ist das Kopftuch muslimischer Lehrerinnen. Sie versuchen, das Neutralitätsgebot aufzuweichen, indem sie sich beim Tragen des Kopftuchs auch im Unterricht auf die Religionsfreiheit nach Art. 4 des Grundgesetzes berufen. Man kann sich lebhaft ausmalen, welche Wirkung von dem Kopftuch ausgeht, das eine Lehrerin trägt. Für Schüler sind Lehrer Vorbilder. Eine Lehrerin mit Kopftuch signalisiert den muslimischen Mädchen, dass eine streng religiöse Einstellung letztlich wichtiger sei als gute Bildung. Solche Mädchen werden kaum Widerstand leisten können, wenn ihre Eltern bestimmen, dass sie nach der 10. Klasse die Schule verlassen, um zu heiraten. Dabei zählen gerade muslimische Mädchen, wenn sie es bis zum Abitur schaffen, zu den Besten. Wenn die Religionsfreiheit von Lehrerinnen mit dem Neutralitätsgebot kollidiert, sollten der Bildungsauftrag der Schule und das Schülerwohl den Ausschlag geben. Wenn dazu die Schulgesetze nicht ausreichen, muss die Neutralität der Schule im Grundgesetz verankert werden.
Der Unterricht in der demokratischen Schule will die Schüler zu mündigen Staatsbürgern erziehen. Sie sollen sich für das Gemeinwohl engagieren. Politisches und zivilbürgerliches Engagement ist durchaus erwünscht. Unzulässig ist jedoch, politische Aktivitäten in die Schule hineinzutragen. In Oberstufenkursen trifft man häufig auf Schüler, die in ihrer Freizeit als Aktivisten unterwegs sind. Sie engagieren sich als Klimaschützer, Hausbesetzer oder Flüchtlingshelfer. Im Rahmen eines gut geführten Politikunterrichts dürfen sie in Referaten ihr Anliegen erläutern. Keinesfalls aber sollte ihnen erlaubt sein, Mitschüler zu agitieren oder gar zu bedrohen, wenn sie ihrem Anliegen nichts abgewinnen können. Die Vertreter von Fridays for Future schrammten haarscharf an dieser Grenze vorbei, als sie sich mit Mitschülern anlegten, die es ungerecht fanden, dass sie für das Schwänzen am Freitag keine Fehlzeiten eingetragen bekommen. Die hymnische Bewunderung, die Fridays for Future in der Öffentlichkeit erhält, spiegelt nach meiner Erfahrung nicht die Stimmung in den Klassen wider. Von ihren Mitschülern werden die Klimaaktivisten häufig als arrogant und überheblich wahrgenommen.“ FFF“ hat auch Lehrkräfte in Versuchung geführt, von der Anwendung gültiger Fehlzeitenregelungen abzusehen. Eine solche Pädagogik im Dienste des Guten verletzt ein wichtiges schulisches Prinzip: die Gleichheit aller Schüler. Die Regeln müssen für alle gelten. Würde man sie aufweichen, öffnete man die Büchse der Pandora. Bald würden Aktivisten mit weniger honorigen Zielen dasselbe Recht beanspruchen. Die Demokratie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass ihre Spielregeln sakrosankt sind. Das sollte auch für die Schule gelten, in der Schüler die Demokratie erproben.
Ein wichtiges Prinzip der Schule ist die Wissenschaftlichkeit des Unterrichts. In den „exakten“ Fächern, Mathematik und Naturwissenschaften, ist das unumstritten. Schwieriger wird es in den Gesellschaftswissenschaften, vor allem in Politischer Wissenschaft und Geschichte. In diesen Fächern gibt es keine objektive Wahrheit, sondern nur Annäherungen, sinnfällige Evidenzen, vorläufige Erkenntnisse, die sich durch Neubewertung der Quellen oder durch gesellschaftliche Erfahrungen verändern können. Ein Blick in die Lehrwerke der Schulbuchverlage zeigt, wie man durch selektive Quellenauswahl und durch geschickt formulierte Kommentare das Wissen der Schüler lenken kann. Häufig wird die Soziale Markwirtschaft in Frage gestellt, indem ihr die Attitüde eines Raubtierkapitalismus unterstellt wird. Es gibt kaum ein Lehrwerk über die Wiedervereinigung, indem nicht der Treuhandanstalt unterstellt würde, die Wirtschaft der DDR ruiniert und an westdeutsche Konzerne verscherbelt zu haben. Seit die Archive der Treuhandanstalt für wissenschaftliche Recherchen zugänglich sind, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Die Treuhand hat aus dem Staatsbankrott der DDR das Optimum herausgeholt. Die Schulbücher der Verlage sollten genauer auf ideologische Voreingenommenheit untersucht werden.
Das Fach Geschichte ist neuerdings Ziel von tagespolitisch motivierten Interventionen. Im Leistungskurs Geschichte treten Schüler auf, die – beeinflusst vom Konzept des Cancel Culture – historische Personen nachträglich moralisch diskreditieren und dazu aufrufen, Statuen solcher Personen aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. So werden Bismarck die Verbrechen des deutschen Kolonialismus angelastet, seine Verdienste um Deutschland – Reichseinigung und Sozialgesetzgebung – hingegen ausgeblendet. Einem solchen unhistorischen Ansinnen sollten die Geschichtslehrer deutlich entgegentreten. Es gehört zu den Axiomen der Geschichtswissenschaft, dass man historische Ereignisse und Personen nur aus der Zeit heraus verstehen kann. Wenn man von Gegenwartsproblemen ausgeht, ist man immer versucht, die Messlatte heutiger Demokratie- und Moralvorstellungen an vergangene Zeiten anzulegen, was zu falschen Urteilen führen muss. Kein vernünftiger Mensch würde Martin Luther aus dem Gedächtnis der Deutschen löschen wollen, weil er dazu aufrief, die aufständischen Bauern zu erschlagen und die Synagogen der Juden niederzubrennen. Seine Verdienste um die Erneuerung des christlichen Glaubens und um die Erschaffung einer deutschen Einheitssprache durch seine Bibelübersetzung wiegen die Schattenseiten seines Wirkens auf. Die Nachgeborenen müssen lernen, die Ambivalenz historischer Personen zu ertragen. Das kollektive Gedächtnis einer Nation benötigt ein Geschichtsbild, dass nur der historischen Wahrheit verpflichtet ist und sich tagespolitischen Instrumentalisierungen entzieht. Ein guter Geschichtsunterricht kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten.
Willy Brandt sagte im Jahre 1969, in einer ähnlich turbulenten Zeit wie der heutigen, den bemerkenswerten Satz: „Die Schule der Nation ist die Schule.“ Er hätte sich damals nicht träumen lassen, dass diese Aussage im Jahre 2021 eine ganz neue Wahrheit gewinnt.