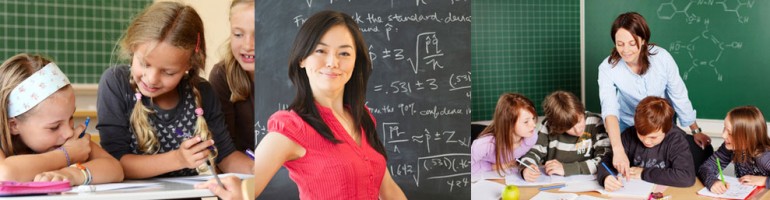Alle wichtigen Lernstudien weisen nach, dass der Lernerfolg der Schüler in erster Linie von der Lehrkraft abhängt. Während die Bildungspolitik gerne das Heil in strukturellen Reformen sucht, liegt das größte Potential für Schulqualität in der Verbesserung des Unterrichts.
Veröffentlicht auf CICERO-online am 6. April 2024
Vor einiger Zeit fand in einer Schule in England ein aufschlussreiches pädagogisches Experiment statt. Zwei bestehende Klassen sollten neu aufgeteilt werden. Dazu wurde ein Test angesetzt. Die guten Schüler sollten in Klasse A, die weniger guten in Klasse B kommen. Dass dies ein pädagogisches Experiment war, wussten nur die beteiligten Wissenschaftler und der Schulleiter. Der Test verlief wie alle anderen Leistungsüberprüfungen auch. Das Ergebnis brachte das übliche Notenbild. Es gab alle Noten von 1 bis 5. Die Schüler wurden in der Folge nach folgendem Prinzip auf die beiden Klassen verteilt: Die Schüler mit einer ungeraden Ziffer in der Rangordnung kamen in Klasse A, die mit den geraden Ziffern in Klasse B. Die Rahmenbedingungen waren in beiden Klassen gleich, z.B. die Ausstattung der Räume, die Auswahl der Lehrer, die Lernmaterialien. In beiden Klassen saßen also Kinder mit der gleichen Begabungsmischung. Danach passierte etwas Bemerkenswertes: In den Köpfen der Beteiligten steckten die klugen Kinder in Klasse A, die weniger Klugen in Klasse B. Die Eltern von Kindern in Klasse A zeigten sich angenehm überrascht, dass ihr Kind so gut abgeschnitten hatte, und sparten nicht mit Lob und Belohnungen. In Klasse B hingegen hielten einige Eltern ihren Kindern vor, sich nicht genügend angestrengt zu haben. Sie entzogen ihnen bestimmte Annehmlichkeiten wie Taschengeld oder technische Geräte. Auch die Lehrer behandelten die Kinder in Klasse B anders, da sie von ihnen nicht besonders viel erwarteten. Die Illusion zweier Klassen mit unterschiedlich begabten Kindern wurde ein ganzes Schuljahr hindurch aufrechterhalten. Danach wurde abermals ein Test durchgeführt. Das Ergebnis war: Die Kinder der Klasse A zeigten weitaus bessere Leistungen als die Kinder der Klasse B. Die Testergebnisse bestätigten also nicht die Realität der Begabungsmischung, sondern die Zuschreibung von Begabung in den Köpfen der Lehrer und Eltern. Das, was man den Kindern der Klasse B ein ganzes Schuljahr hindurch weisgemacht hatte, ist zuletzt tatsächlich eingetreten: Sie sind jetzt wirklich Kinder der Klasse B geworden. Und sie haben selbst daran mitgewirkt: Weil sie sich selbst für schlechter hielten, wurden sie es auch.
Ermutigung wirkt Wunder
Ermutigung der Schüler durch die Lehrkraft ist eine der stärksten Produktivkräfte im Unterricht. Entmutigung bewirkt nicht nur das Gegenteil, es kann bei den Schülern zu Schulangst, Schulschwänzen und Schulversagen führen. In der Lernstudie des neuseeländischen Pädagogen John Hattie „Lernen sichtbar machen“ (2013) nimmt das Problem von Ermutigung und Entmutigung einen großen Raum ein. Er hält die positive Einstellung des Lehrers zu seinen Schülern für wichtiger als eine hohe Fachkompetenz oder einen technikgestützten Unterricht. In den Worten des Forschers: „Die Wirkfähigkeit der positiven Lehrer-Schüler-Beziehung ist entscheidend dafür, dass Lernen stattfinden kann.“ Um dieses Verhältnis zu testen, stellte Hattie in Schulklassen die lapidare Frage: „Mag euch euer Lehrer?“ – Auffällig war, dass Kinder aus der bildungsbürgerlichen Schicht häufiger mit „Ja“ antworteten als Kinder aus ethnischen Minderheiten oder aus der einheimischen Unterschicht. Hier scheint das stattgefunden haben, was Hattie „Etikettierung“ nennt, die Zuschreibung von Fähigkeiten und die eigene oft unbewusste nonverbale Kommentierung der Etikettierung. Untersuchungen bei Schulschwänzern haben ergeben, dass sie die Schule nicht schwänzen, weil sie leistungsschwach sind und sich deshalb vor ihren Mitschülern schämen, sondern weil sie bestimmte Lehrer nicht mögen. Sie mögen sie deshalb nicht, weil sie sich von ihnen ungerecht behandelt, ja stigmatisiert und ausgegrenzt fühlen. Umgekehrt kennt man das Phänomen, dass Schüler zu Hause sagen, für den neuen Mathelehrer würden sie die Hausaufgaben auch dann erledigen, wenn sie keinen Spaß machen. Sie machen sie ihm zuliebe, weil sie ihn mögen und deshalb nicht enttäuschen wollen. Sigmund Freud, der große Seelenerkunder, schrieb in seinen Jugenderinnerungen: „Ich weiß nicht, was uns stärker in Anspruch nahm und bedeutsamer für uns wurde, die Beschäftigung der uns vorgetragenen Wissenschaft oder die mit den Persönlichkeiten unserer Lehrer, und bei vielen führte der Weg zu den Wissenschaften nur über die Person des Lehrers.“ („Zur Psychologie des Gymnasiasten“, 1914)
Positive Verstärkung als Lernstimulans
In dem Spielfilm „Club der toten Dichter“ des australischen Regisseurs Peter Weir lernen wir den Englischlehrer John Keating kennen, der an einem vornehmen Internat unterrichtet. Sein Unterricht verblüfft die Schüler schon in der ersten Stunde. Mit unkonventionellen Methoden fordert der Lehrer sie zu selbstständigem Handeln und freiem Denken auf. Da ihm die individuelle Förderung seiner Schüler sehr wichtig ist, ermutigt er sie immer wieder, sich mehr zuzutrauen und ihre Möglichkeiten auszuloten. Selbst die gehemmten Schüler schaffen es allmählich, ihren eigenen Wert zu erkennen und Selbstvertrauen aufzubauen – der Garant für erfolgreiches Lernen. John Keating ist quasi der Prototyp des ermutigenden Lehrers.
Der Effekt der Wirksamkeit von positiver Verstärkung war schon vor Hattie bekannt. Die Bildungsforscher Rosenthal und Jacobsen kamen in ihrem Buch „Pygmalion im Unterricht“ zu dem Ergebnis, dass die Erwartungen des Lehrers starke Einflüsse auf den Erfolg des Lernverhaltens der Lernenden haben. Erwartet er, dass die Kinder den Stoff verstehen, werden sie dies eher erreichen, als wenn er von Anfang an daran zweifelt, weil er die Klasse für wenig leistungsstark hält.
Der Lehrer entscheidet über den Lernprozess
Ob Schüler erfolgreich lernen, bestimmt vor allem der Lehrer. Er hat es in der Hand, den Unterricht so zu gestalten, dass der Lerneffekt groß ist. Er kann aber auch das Gegenteil bewirken. Während in letzter Zeit einige Kultusminister den Lehrer nur noch als „Lernbegleiter“ sehen, der lediglich die Selbstorganisation der Schüler beim offenen Lernen unterstützt, fordert Hattie vom Lehrer, dass er den Unterricht von A bis Z steuert, weil dies die höchste Wirksamkeit entfaltet. Hattie begreift den Beruf des Lehrers als ein Handwerk, das er beherrschen und professionell ausüben muss. Dem pädagogischen „Handwerker“ stehen dabei viele Stellschrauben zur Verfügung, an denen er drehen kann, um den Output seiner Tätigkeit zu erhöhen. Jede Kleinigkeit ist dabei wichtig, weil auch sie zum Lernerfolg beitragen kann. Wenn es einer Lehrkraft nicht gelingt, eine ruhige Arbeitsatmosphäre herzustellen, rauscht der Lernstoff an den unkonzentrierten Schülern vorbei. Werden die Hausaufgaben in den geräuschvollen Aufbruch der Schüler am Stundenende hinein erteilt, werden die meisten Schüler sie vergessen. Selbst bei Klausuren und bei Abiturprüfungen hat man schon erlebt, dass die Aufgaben so ungenau gestellt waren, dass die Schüler nur eine vage Vermutung hatten, wie sie die Aufgabe zu lösen hatten. Wenn ein Mathelehrer die Rechenoperationen, die er von seinen Schülern verlangt, an der Tafel nicht anschaulich erklären kann, sind Enttäuschung und Misserfolge bei den Schülern vorprogrammiert. Die Lehrerausbildung muss deshalb vor allem die Handwerkstechnik des Unterrichtens vermitteln. Fest angestellte Lehrkräfte müssten ihre „handwerklichen“ Fähigkeiten häufiger auf den Prüfstand stellen, ihr Knowhow nötigenfalls durch Fortbildungen verbessern.
Warum Lehrkräfte scheitern
In letzter Zeit kann man immer wieder Erfahrungsberichte von Lehrern lesen, die den Beruf aufgegeben haben. Darunter sind auch Quereinsteiger, die sich von den staatlichen Werbeoffensiven haben verlocken lassen, in den Lehrerberuf zu wechseln. Woran scheitern diese Lehrer? Eine Lehrerin warf schon nach einem Jahr das Handtuch. Ihre Gründe gab sie in einem Interview bekannt: „Viele Kinder sind verhaltensauffällig, gewaltbereit, desinteressiert und kommen ohne Lebenskompass in die Schule.“ Die Lehrerin hatte wohl erwartet, dass sie pflegeleichte, gut erzogene Schüler vor sich haben würde. Ohne erzieherisches Einwirken auf die Klasse geht es heute nicht mehr. Da immer mehr Eltern die Erziehung ihrer Kinder an Kita und Schule delegieren, müssen sich diese Einrichtungen dieser Aufgabe stellen. Oft braucht es ein halbes Jahr hartnäckiger Erziehungsarbeit, bis eine Klasse so funktioniert, dass man störungsfrei unterrichten kann. Wer sich dieser Aufgabe nicht stellt, wird im Lehrerberuf nicht glücklich werden. „Die Kinder sind unheimlich unruhig, können sich nur kurz konzentrieren, haben eigentlich kein Interesse am Unterrichtsstoff, lenken sich gegenseitig ab und interessieren sich vor allem für den nächsten Streit, damit wieder Action ist.“ So die Beobachtungen der enttäuschten Lehrerin. Gute Lehrer wissen, dass im Lernstoff das spannende Potential verborgen liegt, mit dem man Kinder und Jugendliche fesseln kann. Ich habe in der Ausbildung meiner Referendare viele spannende Unterrichtsstunden gesehen, in denen es den Anfängern gelungen ist, die Schüler aus ihrer Lethargie und Lernunlust herauszureißen. Ein solides Fachwissen, eine kluge Didaktik und ein wenige Talent zum Entertainment sind die Erfolgsfaktoren. „Die Kinder kommen zu spät, haben Hefte, Bücher vergessen oder gleich ganz verloren, Stift fehlt, Ratzefummel auch, gefrühstückt wurde auch nicht, Hausaufgaben sind vergessen oder falsch, jetzt erstmal dreimal im Unterricht aufs Klo, zum Mülleimer, in Ruhe alle Buntstifte anspitzen und ca. fünfmal alles vom Tisch runterfallen lassen.“ Die Lehrerin scheint in einer Schule ohne Regeln gelandet zu sein. In gut geführten Schulen gibt es klare Vorgaben, wie mit Fehlleistungen und Versäumnissen der Schüler umzugehen ist. Da Kinder Rituale schätzen, braucht man nur ein wenig Geduld, bis die Kinder die nötigen Verhaltensnormen verinnerlicht haben. Warum kapituliert eine junge Lehrerin vor solchen Herausforderungen, anstatt das Handwerk des Unterrichtens von Grund auf zu lernen? Leidenschaft für den Lehrberuf scheint sie nicht besessen zu haben.
Feedback: Wie gut ist der Unterricht wirklich?
Viele Lehrer haben ein zugewandtes, freundschaftliches Verhältnis zu ihren Schülern. Daraus leiten sie – freilich oft zu Unrecht – ab, dass die Schüler bei ihnen auch viel lernen. Ein gutes Lernklima, Wertschätzung für die Kinder und Zugewandtheit sind notwendige Bedingungen erfolgreichen Unterrichtens. Sie garantieren jedoch für sich allein noch nicht den optimalen Lernerfolg. Der Lehrerberuf kommt der Neigung des Menschen entgegen, sich in Routinen bequem einzurichten. Gerade in der Lehrtätigkeit sind aber falsche Routinen schädlich, weil sich die Lernbedingungen vor allem bei den Schülern ständig ändern. Aufbrechen kann man schädliche Routinen nur, indem man die Selbstreflexion des Lehrers stärkt. An Schulen, die es den Schülern ermöglichen, den Unterricht ihrer Lehrer zu bewerten, haben sich die Lernergebnisse schon nach zwei Jahren deutlich verbessert. Die Bewertungen der Lehrer durch ihre Schüler sind verlässlich, vertrauenswürdig und aussagekräftig. Es sind keineswegs reine Beliebtheitswettbewerbe, wie die Lehrerverbände unterstellen, weil ihnen der ganze Trend nicht gefällt. Schüler haben ein gutes Gespür dafür, ob sie bei einem Lehrer etwas lernen oder nicht. Die Fragebögen der Lehrerbewertung enthalten dafür die passenden Punkte: die Fähigkeit des Erklärens, vorhandenes Fachwissen, die Wahl effektiver Lernmethoden und das Verhältnis der Lehrkraft zu seinen Schülern. Schulen, die diesen Weg gegangen sind, berichten, dass Schüler bei der Bewertung des eigenen Lernfortschrittes in der Klasse oder im Kurs sehr treffende Urteile fällen. Sie können vor allem beurteilen, ob sie die Lernfortschritte primär den guten Unterrichtsmethoden der Lehrkraft oder in erster Linie eigenen Anstrengungen verdanken.
„Wir lassen keine(n) zurück!“
Schüler sind den Lehrern dankbar, wenn sie sich darum kümmern, wenn sie in einzelnen Fächern ins Hintertreffen geraten. Gemeinsam mit einer Kollegin habe ich beschlossen, eine uns anvertraute 7. Klasse (in Berlin ist dies die Eingangsklasse im Gymnasium) so zu unterstützen, dass die ganze Mittelstufe hindurch kein einziger Schüler sitzen bleibt. Unser Motto hieß: „Wir lassen keine(n) zurück! Jede(r) kann es schaffen!“ – Wir initiierten ein Patenschafts-Modell. Jedem Schüler wurde in seinem schlechten Fach ein guter Schüler aus der Klasse als Lernpate zur Seite gestellt. Er unterstützte ihn bei den Hausaufgaben, lernte mit ihm gemeinsam auf Tests und Klassenarbeiten. Reichte die Hilfe durch Mitschüler nicht aus, nahmen wir Kontakt zu den jeweiligen Fachlehrern auf, um sie für weitere Unterstützungsmaßnahmen zu gewinnen. Der Erfolg blieb nicht aus: Vier Jahre lang blieb kein einziger Schüler der Klasse sitzen. Quantitativ bestraften wir uns selbst, weil am Ende jedes Schuljahres „von oben“ Sitzenbleiber in unsere Klasse kamen. Zum Schluss saßen 36 Schüler in der Klasse. Qualitativ hat dieses Modell jedoch die Klasse enorm gestärkt. Der Zusammenhalt und das Selbstbewusstsein waren nach vier Jahren ungleich stärker entwickelt als in den Parallelklassen. Aus einer Ansammlung von Einzelkämpfern war eine echte Klassengemeinschaft entstanden. Damit haben wir – ohne es zu wissen – ein wichtiges Merkmal erfolgreichen Lernens in der Hattie-Rangfolge erfüllt. Er siedelt den „Klassenzusammenhalt, das Gefühl, dass alle (Lehrperson und Lernende) gemeinsam für positive Lernerfolge arbeiten“, recht hoch an (Faktor 39 von 138).
Keine weiteren Strukturreformen – den Unterricht verbessern!
In Deutschland haben Bildungspolitiker seit jeher ein großes Faible für die Erfindung neuer schulischer Strukturen. An der Organisationsschraube zu drehen ist für Nicht-Experten, wie es Politiker oftmals sind, allemal leichter, als sich auf die komplexen Abläufe im Unterricht einzulassen, um dort Verbesserungen zu erzielen. Wissenschaftler warnen immer wieder, politisches Handeln bleibe wirkungslos, wenn es nur auf die Schulorganisation abzielt. Das Kerngeschäft der Schule, der Unterrichtsprozess, bleibe davon nämlich unbeeinflusst. Bessere Lernergebnisse bei den Schülern lassen sich nur erzielen, wenn man den konkreten Unterricht verbessert. Wenn die „neuen“ Organisationsformen nach rein ideologischen Vorgaben gewählt werden, können sich die Lernergebnisse der Schüler sogar verschlechtern. Ein Beispiel dafür ist die Schulreform von 2010/2011 in Berlin.
Schulreform mit zweifelhaftem Ergebnis
Ab dem Schuljahr 2010/2011 gibt es in Berlin nur noch zwei weiterführende Schularten: das Gymnasium und die Integrierte Sekundarschule. Letztere entstand durch die Fusion aus Haupt- und Realschule. Die Ziele der damaligen von der SPD geführten Bildungsverwaltung klangen verheißungsvoll: Es gehe um die „bestmögliche Förderung der Schüler und Schülerinnen entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen, um den für sie bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen – unabhängig von ihren familiären und sozialen Voraussetzungen“. Die Warnungen des Deutschen Lehrerverbandes, der auch Haupt- und Realschullehrer vertritt, die Reform zerstöre gewachsene und funktionierende Schulkulturen, wurden von der Politik in den Wind geschlagen. Da für die diversen Klassen der Sekundarschulen kein Differenzierungsmodell vorgeschrieben wurde, wählten die meisten Schulen die Binnendifferenzierung. Das Erfolgsmodell der Gesamtschule, die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch in leistungsgerechten Kursen und nicht im Klassenverband zu unterrichten, kam unter die Räder. Nur einige wenige Gesamtschulen hielten auch unter dem neuen Label Sekundarschule an dem bewährten Modell fest. Schon nach wenigen Schuljahren waren die Ergebnisse der Reform zu besichtigen: Beim Mittleren Schulabschluss schnitten die neuen Sekundarschulen schlechter ab als die ehemaligen Gesamtschulen und Realschulen. Das Versagen der Diversitätsdidaktik – zentrale Ursache für die Misserfolge deutscher Schüler bei PISA 2022 – setzte in Berlin mit der Schulreform 2010/2011 ein. Das politische Versprechen, die Schüler zu besseren Lernergebnissen zu führen, hat sich ins Gegenteil verkehrt: Die Preisgabe des begabungsgerechten Lernens hat die Lernergebnisse der Schüler massiv verschlechtert. Seit der umstrittenen Schulreform belegen Berlins Schüler im Ranking der Bundesländer den letzten Platz.
Eine Kultur des Feedbacks etablieren
Als Lehrer habe ich ein pädagogisches „Gesetz“ gelernt: Die größten Unterschiede im Lernzuwachs der Schüler gibt es nicht zwischen Schulen und Schulformen, sondern zwischen einzelnen Klassen. Jeder Schulleiter weiß aus eigener Erfahrung, dass im Englisch- oder Matheunterricht der Lernvorsprung zwischen einem gut und einem nachlässig geführten Unterricht bis zu einem halben Schuljahr betragen kann. In den künstlerischen Fächern, die ihre Ergebnisse oft der Schulöffentlichkeit präsentieren, sind die unterschiedlichen Qualitäten der Lehrkräfte mit Händen zu greifen. Wenn man dies weiß, kann es nur einen Weg aus der Schulmisere geben: die Lehrer müssen so ertüchtigt werden, dass sie den bestmöglichen Unterricht abliefern können. Dabei sind Methoden der Selbst- und Fremdevaluation äußerst hilfreich. Die Kultur des Feedbacks hat den Lernprozess an den Schulen revolutioniert. Die Lehrer, die sich diesem Trend verweigern, werden in den Lehrerkollegien bald ins Hintertreffen geraten. Die Lehrkräfte, die sich die Verbesserung des Unterrichts auf die Fahnen geschrieben haben, sollten sich künftig bei der Ausübung ihres Handwerks nicht von sachfremden, politisch motivierten Zumutungen beirren lassen. Ein wenig mehr Handwerkerstolz könnte nicht schaden.