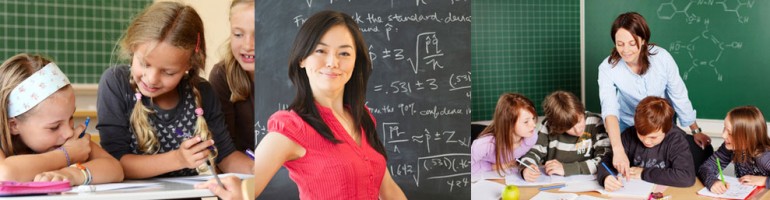Nach PISA-Schock: Ehemaliger Gymnasiallehrer hält nichts von pauschaler Kritik „am System“
Als Reaktion auf das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler bei PISA werden Forderungen nach einem radikalen Umbau des Schulsystems laut. Der frühere Berliner Lehrer Rainer Werner* sieht den Veränderungsbedarf eher woanders.
Veröffentlicht auf Focus-online am 4. Januar 2024
Kürzlich haben wir mit einem früheren Lehrer gesprochen, der aufgezählt hat, wo das deutsche Schulsystem aus seiner Sicht überall krankt: An den Schulen geschehe das Gegenteil von guter Wissensvermittlung, der Stoff würde den Schülerinnen und Schülern eingetrichtert, das Wissen sei lediglich kurzfristig abrufbar – für Tests – und die Inhalte hätten nur wenig mit der späteren beruflichen Realität zu tun. Sehen Sie das auch so?
Überhaupt nicht, aber die Argumente sind mir natürlich wohlbekannt. Und die Systemkritik geht ja noch weiter. Schauen Sie, allein im Jahr 2023 haben über 1000 Lehrer ihren Beruf aufgegeben. Das, was da von vielen zu hören ist, klingt immer wieder ähnlich. Besonders gerne wird über das technische Equipment gelästert: Da gebe es noch langsame und laute Kopierer, aber keine Scanner. Und Kreidetafeln wie im Mittelalter. Als wäre das für den Lernerfolg der Schüler entscheidend. Als wäre die Kernfrage nicht eine andere.
Nämlich?
Welche Didaktik muss ich anwenden, um Kinder mit dem Weltwissen vertraut zu machen? Darum geht es. Die schwedischen Schulbehörden sind übrigens gerade dabei, ihre Konzepte zu überdenken. Man hat nämlich gesehen: Schulen, die viel digital arbeiten, schneiden im Vergleich zu „Bücherschulen“ schlechter ab. Nun holt man die Bücher zurück in den Unterricht. Zurecht! Nicht alles, was von den grünen Tischen der Hochschulen kommt, ist zielführend. Bei der kollegialen Hospitation am Gymnasium erlebte die Biologiestunde eines älteren Kollegen in einer 8. Klasse. Er hat praktisch nichts von dem, was die moderne Pädagogik für wichtig hält, in seinem Unterricht beherzigt. Er dozierte fast die ganze Stunde und zeigte den Schülern nur vier Fotografien. Und doch hingen die Schülerinnen und Schüler an seinen Lippen.
Beschreiben Sie mal, was machte diesen Lehrer aus?
Zwei Dinge. Erstens: Ein blendendes Fachwissen. Und zweitens: Er konnte brillant erzählen. In der besagten Stunde berichtete er über das soziale Miteinander der Bonobo-Schimpansen, bei denen die Weibchen das Sagen haben. Der Lehrer erklärte, dass das dort herrschende Matriarchat den Stamm überaus friedfertig mache. Ganz anders als bei den Gorillas, wo die Männchen herrschen und zuweilen sogar Babys töten, damit sie schneller wieder eigenen Nachwuchs zeugen können. Wie auch immer: Der Lehrer, Typ Rauschebart, hat den Stoff unglaublich spannend vermittelt, im Klassenzimmer war es mucksmäuschenstill. Ich wette, der Lernerfolg war immens – bei minimalem Medieneinsatz. Für mich ist die wichtigste Eigenschaft eines Lehrers, dass er intuitiv erkennt, ob sein Unterricht wirksam ist oder nicht. Dies sieht man an der Aufmerksamkeit der Schüler, manchmal auch an ihren leuchtenden Augen.
Und wenn er Defizite an seinem Unterricht erkennt?
Dann muss er etwas ändern. Auch mir ist es als Berufsanfänger passiert, dass ich vor einer gähnenden Klasse gestanden bin. Wenn ich an den Kindern vorbei unterrichtet habe, war das immer ein klares Indiz dafür, dass irgendetwas passieren musste. Sowohl in Geschichte als auch in Deutsch habe ich meinen Unterricht immer wieder radikal auf den Prüfstand gestellt. Das kann man an jeder Schule tun. Und in jedem Fach.
Tatsächlich? Man hört doch immer wieder, Lehrer hätten so wenig Freiheiten. Sie seien gefangen im starren Korsett des Lehrplans.
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Zumindest nicht für Berlin, wo die Lehrpläne in den frühen 2000er Jahren von der überbordenden Stofffülle befreit wurden und seitdem Rahmenlehrpläne heißen. Lehrer haben enorme Freiheiten in der Wissensvermittlung. Natürlich kann man den Satz des Pythagoras nicht auslassen, der muss in der neunten Klasse in Mathe vermittelt werden. Aber nehmen wir das Fach Deutsch an der gymnasialen Oberstufe. Da wird nur vorgegeben, welche literarischen Epochen ich unterrichten muss, z.B. Sturm und Drang, Klassik und Romantik. Aber wie ich diese Themen mit Texten fülle, bleibt allein mir überlassen. Für mich sind das hohle Phrasen, wenn Lehrkräfte über ein System lamentieren, das angeblich keinen Handlungsspielraum lässt. Spätestens seit 2013 wissen wir auch, was für eine gute Ausübung des Lehrerberufs entscheidend ist.
Was denn?
Die Studie des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie, die damals in deutscher Sprache veröffentlicht wurde, war eine Sensation. Ich habe mir die beiden Bücher damals gleich gekauft. Sehr verkürzt zusammengefasst lautet die Botschaft der Studie: Der Lehrerberuf ist ein Handwerk.
Heißt?
Wenn ich als Lehrer feststelle, dass mein Unterricht nicht optimal verläuft, muss ich mein handwerkliches Geschick verbessern. Deshalb bin ich auch ein Verfechter des Prinzips „Schüler benoten ihre Lehrer“.
Nette Idee…
… die an dem Berliner Gymnasium, an dem ich bis zu meiner Pensionierung unterrichtet habe, eingeführt wurde. Ich war damals Mitglied einer so genannten Steuergruppe, die Konzepte ausarbeiten sollte, wie man den Unterricht verbessern könnte. In den 2000er Jahren haben wir dann zwei Neuerungen eingeführt. Einmal das offene Klassenzimmer: Lehrer konnten sich von da an gegenseitig im Unterricht besuchen. Und dann die Benotung der Lehrer durch ihre Schüler. In altersgerechten Fragebögen wurden die Eigenschaften erfragt, die einen guten Lehrer ausmachen. Es konnten Noten von 1 bis 4 erteilt werden. Beide Neuerungen waren damals noch absolute Tabus. Etwa zehn Lehrer verließen danach die Schule, weil sie sich mit diesen Methoden nicht anfreunden konnten. Aber das war kein Problem, denn in der Folge haben sich viel mehr Lehrer um eine Versetzung an unsere Schule bemüht, als es offene Stellen gab. Wir fragten sie immer: Wisst ihr, was auf euch zukommt? Ihr müsst euch von den Schülern bewerten lassen. Das ist doch genau das, weshalb wir kommen wollen, bekamen wir zur Antwort. Man sieht: Lehrer, die sich ihres Könnens und ihrer Ausstrahlung bewusst sind, haben mit einem solchen Bewertungssystem keinerlei Probleme.
Hand aufs Herz: Gab es auch mal schlechte Noten von den Schülern?
Schlecht wurden z.B. Lehrer bewertet, wenn sie Klassenarbeiten zu spät zurückgegeben haben, oder Mathelehrer, wenn sie Rechenoperationen nicht verständlich erklären konnten. Mir selbst wurde vorgeworfen, mein Erzähldrang sei manchmal ein bisschen zu stark, ich würde dann zu sehr vom Thema abkommen. Bei sowas muss man cool sein. Ich habe mich jedenfalls immer bemüht, das Ganze als willkommene Rückmeldung anzusehen, um den Unterricht weiter zu verbessern. Vor zwei Jahren – zehn Jahre nach meiner Pensionierung – hat dieses Gymnasium von 90 Gymnasien in Berlin den besten Inspektionsbericht der Schulbehörde erhalten. Nicht primär wegen einer supermodernen Ausstattung! Sondern weil hier Lehrkräfte arbeiten, die stets bemüht sind, ihren Unterricht zu verbessern.
Der Kollege, den wir hier neulich im Interview hatten, sieht die große Diversität der Schulklassen als eine der Hauptursachen für das schlechte Abschneiden deutscher Schüler bei PISA.
Dass die größer gewordene Diversität für den Unterricht an allen Schulformen eine Herausforderung darstellt, ist – glaube ich – unbestritten. Es hilft aber nichts: Die Schulen müssen lernen, mit dieser Situation in den Klassen produktiv umzugehen.
Was heißt das?
Ich kenne Schulen, die einen sehr hohen Anteil von Migrantenkindern haben und trotzdem gute Lernergebnisse erzielen.
Wie schaffen sie das?
Die Schule, an die ich denke, ist eine Grundschule in Berlin-Neukölln, die lange von einer sehr engagierten Schulleiterin geführt wurde. Da gab es muslimische Väter, die es unterstützen, wenn ihre Söhne den Lehrerinnen gegenüber respektlos auftreten. Die Schulleiterin hat diese Väter in die Schule eingeladen, um sie im pädagogischen Gespräch mit den Gepflogenheiten einer demokratischen Schule vertraut zu machen.
Und das hat gefruchtet?
In Berlin gibt es alle fünf Jahre eine Schulinspektion. Besagte Schule schneidet dabei hervorragend ab. Das Konzept scheint also aufzugehen.
Welches Konzept genau?
Ich habe keinen detaillierten Einblick in die Praxis der Schule, aber anhand des Inspektionsberichts lässt sich sagen: Nicht die Intelligenz der Schüler allein ist entscheidend für den Lernerfolg, sondern auch und vielleicht sogar vor allem die soziale und kulturelle Prägung und die so genannten Sekundärtugenden – also Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz, Fleiß und Konzentration. Richtig ist: Das sind Dinge, die viele Schüler heute zu Hause nicht mehr lernen. Schule kann sich also nicht mehr uneingeschränkt darauf verlassen, dass in den Familien die Regeln des verträglichen Miteinanders in der Gemeinschaft hinlänglich vermittelt werden. Die genannte Grundschule hat sich deshalb die erzieherische Arbeit genauso auf die Fahnen geschrieben wie die sprachliche Förderung der Kinder.
… Was geschieht, wenn eine Schule die Herausforderung der Erziehungsarbeit nicht annimmt?
Für mich ist es undenkbar, dass eine Schule vor dieser Herausforderung kapituliert! Das Gegenteil muss passieren. Ja, es stimmt: Wenn Eltern sich nicht um ihre Kinder kümmern, ihre Erziehung vernachlässigen und die Kunst der verbalen Auseinandersetzung zu Hause nicht eingeübt wird, werden im schulischen Leben zunehmend die Fäuste geschwungen. Die kleinen Paschas, von denen Friedrich Merz gesprochen hat, sind leider Realität. Und nicht nur die. Die Klassen werden bunter – nicht nur durch die Migration, auch durch das, was sonst in der Gesellschaft passiert, in der so gennannten Unterschicht genauso wie beim Bildungsbürgertum. Eltern lassen sich öfter scheiden, Depressionen nehmen zu, Armut macht Familien zu schaffen. Die Schulprobleme der Kinder seien oft Lebensprobleme, hat der Reformpädagoge Hartmut von Hentig einmal gesagt. Das entspricht auch meiner Erfahrung. Doch genau hier muss Schule im Rahmen des Möglichen – und ich sehe, dass vieles möglich ist – aktiv werden und kreative Formen des Erziehens entwickeln. Lehrer, die den Ball nur reflexartig ans Elternhaus zurückspielen, tun weder dem Kind noch sich selbst – denken Sie an die 1000 Lehrer, die allein im letzten Jahr kapituliert haben – einen Gefallen.
Aber hat die Schulleiterin, die die muslimischen Väter an die Schule zitiert hat, nicht genau das getan: Den Ball ans Elternhaus gespielt?
Es stimmt schon, das war eine klare Ansage – aber vermutlich kam sie in Kombination mit einem Angebot zur Kooperation. Nur so führt das Ganze meiner Erfahrung nach zum Erfolg.
Was schlagen Sie vor?
Einige Schulen haben gute Erfahrungen mit so genannten Erziehungsvereinbarungen gemacht, in denen die Eltern sich mit ihrer Unterschrift verpflichten, auf eine Verhaltensänderung ihres Sohnes oder ihrer Tochter hinzu- wirken.
Wie kann man sich so etwas konkret vorstellen?
Als schön gestaltetes Dokument, in das der Name des Kindes, die Namen der Eltern und die des Klassenlehrers eingetragen werden. Da steht dann zum Beispiel: Herr und Frau Müller verpflichten sich, darauf zu achten, dass Lisa spätestens um zehn ins Bett geht und dass der Fernsehkonsum auf maximal eine Stunde pro Tag reduziert wird. Außerdem lassen sie sich täglich Lisas Hausaufgaben zeigen.
Glauben Sie nicht, dass das manchen Eltern zu viel Einmischung ist?
Ich glaube, wenn wir uns die aktuellen PISA-Ergebnisse ansehen, sehen wir, dass wir aktiv werden müssen, dringend. Und zwar nicht in Form eines Rundumschlags, bei dem das ganze System auf den Kopf gestellt wird. Entscheidend ist vielmehr, dass diejenigen, die in diesem System arbeiten, die Herausforderungen erkennen – und annehmen. Vergessen wir bitte nicht: Das System, über das wir hier reden, besteht aus Menschen und lebt wie kein zweites davon, dass es von Menschen aktiv gestaltet wird. Noch mal: Im bestehenden Rahmen ist aus meiner Sicht ganz viel möglich. Wenn man will – und es auch entsprechend kommuniziert. Die Schulleiterin der Neuköllner Grundschule hätte auch die Flinte ins Korn werfen und sagen können: „Bei der Elternschaft ist nichts zu machen“. Zum Glück hat sie sich für einen anderen Weg entschieden. Ich würde sagen: Diese Frau hat ihr Handwerk verstanden.
…………………………
* Rainer Werner arbeitete 30 Jahre lang als Lehrer für Deutsch und Geschichte an unterschiedlichen Schulen Berlins. Er hat zahlreihe didaktische Lehrwerke (Ernst Klett und Schroedel Verlag) für den Deutschunterricht verfasst, Vorträge zu pädagogischen und didaktischen Themen gehalten und Seminare und Workshops zur Weiterbildung von Lehrern durchgeführt. Rainer Werner schreibt pädagogische Beiträge für Zeitschriften und Tageszeitungen (FAZ, WELT, CICERO-online) und Bücher über den Lehrerberuf („Auf den Lehrer kommt es an“, „Lehrer machen Schule“).