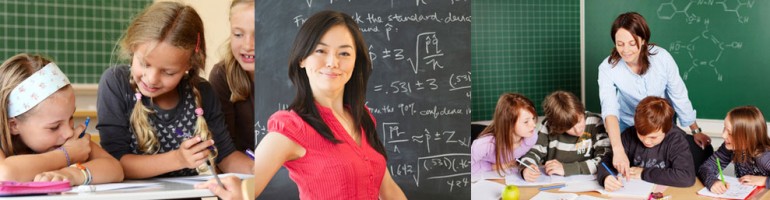Gegen den Willen der Mehrheit der Deutschen hat die Gendersprache Bastionen in Verbänden und Institutionen erobert. Auch viele Redakteure in den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten pflegen diese Sprachvariante. Schülern und ausländischen Deutsch-Lernern erweisen sie damit einen Bärendienst.
Veröffentlicht auf CICERO-online am 24. Dezember 2023
In den meisten Bundesländern stellen es die Schulbehörden den Schulen frei, im internen Schriftverkehr zu gendern. Lehrer verwenden dann in einem Elternbrief die Formulierung Schüler*innen; der Schulleiter spricht in einer Presseverlautbarung von fehlenden Lehrer*innen, die es unmöglich machten, den Unterricht voll abzudecken. Wenn aber eine Klassenarbeit oder eine Klausur ansteht, gelten andere Regeln. Dann müssen die Schüler die deutsche Hochsprache verwenden, die Genderformen nicht kennt. Maßgeblich ist die Schreibweise, die der Rat für deutsche Rechtschreibung in seinen Empfehlungen für geschlechtergerechte Schreibung vom 26.03.2021 niedergelegt hat. Darin heißt es: „Das Amtliche Regelwerk gilt für Schulen sowie für Verwaltung und Rechtspflege. Der Rat hat vor diesem Hintergrund die Aufnahme von Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen.“ Dass sich selbst rot-grün regierte Bundesländer bei prüfungsrelevanten Gegenständen an diese Empfehlung halten, hat juristische Gründe. Sie möchten sich die Klagen von Eltern ersparen, die in der Verordnung der Gendersprache einen rechtswidrigen Akt sehen könnten.
Fünf Bundesländer zeigen Flagge
In meiner Praxis als Deutschlehrer habe ich festgestellt, dass Schüler am Gymnasium geistig so flexibel sind, dass sie zwischen dem privaten Gendern und der Verwendung der deutschen Hochsprache bei Klausuren mühelos hin und her wechseln können. Anders sieht es an Grundschulen, Gesamt- und Sekundarschulen aus. Dort drücken viele Schüler die Schulbank, denen es ohnehin schwerfällt, die deutsche Sprache so zu lernen, dass sie korrekt lesen und schreiben können. Um diesen Kindern nicht noch ein weiteres Handikap aufzubürden, haben drei konservativ regierte Bundesländer, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein, das Gendern in der Schule generell untersagt. Hessen und Bayern wollen bald folgen. Die Kultusminister dieser Länder verweisen auf die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung, der die deutsche Hochsprache für Schulen empfiehlt. In Berlin hat die Schulverwaltung schon vor längerer Zeit den Schulen eine Zweigleisigkeit verordnet. Im Unterricht gilt die Hochsprache ohne Genderformen, im schulischen Schriftverkehr ist der „milde“ Genderstern Pflicht: „Lehrer*innen“, „Schüler*innen“ und „Sozialarbeiter*innen“. Das führt dann aber dazu, dass von „Hausmeister*innen“ die Rede ist, wo es überhaupt keine weibliche Person gibt, die diesen Beruf ausübt. Berlin tickt wieder einmal anders als der Rest der Republik.
Gendersprache im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Ich sehe das Problem darin, dass eine ganze Generation von Schülern mit einer Sprachform aufwächst, die von Interessengruppen mit großer Überzeugungskraft und mit moralischer Überhöhung im öffentlichen Raum verfochten wird. Man begegnet der Gendersprache in halbstaatlichen Institutionen, in den sozialen Netzwerken, in Zeitungen und auch im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk und Fernsehen. In einem Beitrag für die „Berliner Abendschau“, einer Lokalsendung des rbb, berichtete ein Reporter über eine kreative Werbekampagne der Berliner Verkehrsgesellschaft BVG. Dabei sagte er: „1.400 Mitarbeitende hat die BVG in diesem Jahr schon für sich gewinnen können.“ Der Zuschauer der Sendung fragte sich: Nanu! Wie ist das möglich? Stellt die BVG jetzt ihre Mitarbeiter ein zweites Mal ein? Bekommen die „Mitarbeitenden“ jetzt einen neuen, besser dotieren Arbeitsvertrag? Solche Ungereimtheiten passieren, wenn man statt des Gattungsbegriffs „Mitarbeiter“ das Partizip Präsens („Mitarbeitende“) benutzt, was beileibe nicht dasselbe bedeutet. Auf welch dünnen Krücken das Partizip Präsens steht, erkennt man zudem, wenn man von „die Mitarbeitenden“ die Einzahl bildet. Dann heißt es nämlich „der Mitarbeitende“. Man landet also wieder in der männlichen Form, die man ja gerade vermeiden wollte. Wenn man aber „die Mitarbeitende“ sagt, schließt man männliche und diverse Bewerber aus, was diskriminierend wäre, weil für alle Stellenausschreibungen per Gesetz gilt: m / w / d.
Gendersprache produziert Nonsens
Nach meiner Erfahrung gibt es die meisten Ungereimtheiten bei der Verwendung des Partizips Präsens dort, wo eigentlich der Gattungsbegriff angebracht wäre. An den Universitäten hat sich der Begriff „Studierende“ für Studenten durchgesetzt – freilich nur im Plural (aus den genannten Gründen). Dabei wird übersehen, dass ein Studierender nicht dasselbe ist wie ein Student. Wenn ein Student mit seinen Kommilitonen in der Kneipe sitzt, ist er kein Studierender mehr (seine momentan ausgeübte Tätigkeit ist das Trinken). Er bleibt aber ein Student (weil dies seinen generellen Status benennt). Wenn er die Speisekarte studiert, wird er vorübergehend zum „Studierenden“. Die ehemalige grüne Verkehrssenatorin Regine Günther gab in einer Presseerklärung bekannt, dass es in Berlin im Jahr 2020 „einundzwanzig tote Radfahrende“ gegeben habe. Man traut den Grünen ja einiges zu. Dass sie aber Tote zum Leben erwecken können, übersteigt dann doch ihre Fähigkeiten. In einer Zeitungsschlagzeile war zu lesen: „Drei tote Radfahrende durch LKW“. Christen schreiben solche Wunder eigentlich nur Jesus Christus zu. Die Wahlbehörde eines Bundeslandes vermeldete: „Viele Wählende blieben zu Hause“. Diese Menschen waren offenbar zugleich an zwei Orten – ein Beweis für die Gültigkeit der Quantentheorie? Wenn man „Trinker“ zu „Trinkenden“ macht, verharmlost man ihre Sucht. Man verstößt zudem gegen die Statistik. In Deutschland gibt es 84,5 Millionen Trinkende, aber nur 3 Millionen Trinker. Der Sprachforscher Fabian Payr schreibt dazu in seinem Bestseller „Von Menschen und Mensch*innen“: „Das Bemühen, Sprache geschlechtergerecht umzugestalten, führt hier nicht nur zu einem Verlust an sprachlicher Präzision, sondern regelrecht zu sprachlichem Nonsens.“ Wenn Schüler solchen Nonsens-Formulierungen ständig ausgesetzt sind, leidet ihr grammatisches Gespür. Dieses ist aber notwendig, um die Komplexität unseres grammatischen Systems geistig zu durchdringen. Im Grunde schadet die Wurstigkeit und Sorglosigkeit, mit der die Gender-Adepten falsche Sprachformen erfinden, dem Sprachgefühl unserer Schüler.
Wie ein falscher Begriff Karriere macht
Im bewegten Flüchtlingsherbst 2015 hatte ich als Lehrer häufig Diskussionen mit Schülern, die sich als aktive Helfer in der Willkommenskultur betätigten. Irritiert stellte ich fest, dass zwei Schülerinnen plötzlich von „Geflüchteten“ sprachen, wenn sie von ihren Erfahrungen mit Flüchtlingen erzählten. Sie erklärten der Klasse, dass das Wort Flüchtling diskriminierend sei, weil Wörter auf „-ing“ eine negative Konnotation hätten. Als Beispiele nannten sie die Wörter Fiesling, Feigling und Engerling. Der neue, unbelastete Begriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Alle Menschen, die sich für fortschrittlich halten, benutzen inzwischen diese Bezeichnung. Auch Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten sprechen von „Geflüchteten“, wenn sie Flüchtlinge meinen. Leider haben diese Menschen keine deutsche Grammatik zurate gezogen haben, bevor sie sich in die Reihe der Wohlmeinenden eingereiht haben. Sie hätten nämlich lernen können, dass die Bedeutung der beiden Wörter keineswegs identisch ist.
In der Grammatikstunde, die ich in meinen Unterricht einschob, klärte ich die Schüler über die Bedeutungsunterschiede der beiden Begriffe auf. Das Partizip Perfekt „geflüchtet“ verwendet man im Deutschen, um eine situativ bedingte, temporäre Ortsveränderung zu bezeichnen. Ein junges Mädchen kann also seiner Mutter erzählen: „In der Disco war es so heiß, dass ich schon nach einer Stunde ins Freie geflüchtet bin.“ Damit ist sie eine Geflüchtete, aber kein Flüchtling. Ein Junge kann seinem Klassenlehrer berichten: „Tut mir leid, dass ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Aber ich habe zurzeit Liebeskummer und bin deshalb das ganze Wochenende in eine Traumwelt geflüchtet.“ Auch in eine virtuelle Welt kann man flüchten und wird auch hier zum Geflüchteten – nicht aber zum Flüchtling. Nach der Krawallnacht an Silvester 2022 war im Berliner Tagesspiegel zu lesen, die Mieter einer Wohnanlage in Neukölln seien, als ein Reisebus vor ihrem Haus in Brand geriet, aus ihren Wohnungen geflüchtet. Kein vernünftiger Mensch würde behaupten, sie seien nun Flüchtlinge.
Gut gemeint ist nicht immer gut
Ein Flüchtling ist ein Mensch – Mann, Frau, Kind -, der durch Krieg, Verfolgung, Hunger, Naturkatastrophen oder Epidemien gezwungen ist, seine Heimat dauerhaft zu verlassen. Der existentielle Zwang und die oft lebenslange Vertreibung aus der Heimat fehlen bei den „Geflüchteten“ vollständig. Der vermeintlich politisch-korrekte Spracheingriff beim Wort Flüchtling ist ein schönes Beispiel dafür, wie eine gute Absicht mitunter das genaue Gegenteil bewirkt: Die Vokabel „Geflüchtete“ führt zu einer Verharmlosung und Banalisierung eines Tatbestandes, der für die betroffenen Menschen so schrecklich ist, dass sich eine Verniedlichung verbietet. Kein vernünftiger und human denkender Mensch würde bei den Juden, die vor dem Holocaust aus Deutschland geflohen sind, von „Geflüchteten“ sprechen. Und wenn er es täte, würde er sich aus dem seriösen Diskurs verabschieden.
Die Menschen, die das Wort „Geflüchtete“ benutzen, unterliegen noch einem weiteren grammatischen Irrtum. Die Wörter auf -ling sind im Deutschen keineswegs nur negativ konnotiert. Es gibt zwar den Schädling, den Eindringling und den Fiesling, man findet aber auch den Schmetterling, den Säugling und den Liebling. Das Wort Flüchtling befindet sich also in bester Gesellschaft.
UNHCR beklagt die Verharmlosung des Flüchtlingsschicksals
Vor kurzem hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR klargestellt, dass es „das Wort Geflüchtete als abwertend“ betrachte und nicht benutzen wolle. Ein Flüchtling hingegen genieße laut Genfer Flüchtlingskonvention Schutz vor Verfolgung. UNHCR hält den Begriff „Geflüchtete“ für banal, weil “wir doch alle schon einmal vor irgendwas geflüchtet sind“. Der Gebrauch dieses Begriffes rücke die Elendsflüchtlinge zudem in zynischer Weise in die Nähe von Straftätern, die „vor der Polizei geflüchtet“ sind. Dass dies so ist, kann man nachvollziehen, wenn man die täglichen Pressemeldungen der Polizei liest. Dort heißt es z.B.: „Gestern flüchtete ein mutmaßlicher Straftäter vor einer Polizeikontrolle.“ Oder: „Ein zu lebenslänglicher Haft verurteilter Mörder flüchtete in den späten Abendstunden aus der Justizvollzugsanstalt Tegel.“ Dass es sich bei diesen „Geflüchteten“ nicht um Flüchtlinge handelt, ist mit Händen zu greifen. Im Umkehrschluss gilt: Wer Flüchtlinge als „Geflüchtete“ bezeichnet, rückt sie ungewollt in die Nähe von Straftätern. Die Organisation „Pro Asyl“, an deren flüchtlingsfreundlicher Haltung wohl kein Zweifel besteht, sprach sich bereits 2016 für den Begriff „Flüchtling“ aus, weil er die durch internationale Vereinbarungen gewährleisteten Rechte besser garantiere als das banale Wort „Geflüchtete“.
Mein Plädoyer in meinen Klassen war eindringlich: Diejenigen, denen das Schicksal der Flüchtlinge aus den Kriegs- und Hungergebieten dieser Welt am Herzen liegt, sollten zum treffenden Wort Flüchtling zurückkehren. Leider konnte ich nicht alle Schüler überzeugen. Zu tief hatte sich der vermeintlich „unbefleckte“ Begriff in das sprachliche Unterbewusstsein der Schüler eingegraben.
Goethe-Institut auf sprachlichen Abwegen
Das gemeinnützige Goethe-Institut unterhält Filialen an 158 Standorten in 98 Ländern. Sie bieten Sprachkurse in den Niveaustufen A1 bis C2 an. Die Teilnahme an einem Sprachkurs ist für Ausländer aus Nicht-EU-Ländern, die sich in Deutschland einbürgern lassen wollen, verpflichtend. Man sollte annehmen, dass das Goethe-Institut das amtliche Hochdeutsch lehrt, das der Rat für deutsche Rechtschreibung empfiehlt. Weit gefehlt. In den Lernmaterialien, die man im Netz aufrufen kann, findet man einen kruden Gender-Kauderwelsch. Ein Text klingt, als wolle man Grundschulkindern die Segnungen der Gendersprache nahebringen: „Heute sehen wir uns genderinklusive Sprache an. (…) Viele Nomen für Personen und Berufe im Deutschen haben eine maskuline und eine feminine Form: der Schüler und die Schülerin. Und wenn man alle ansprechen möchte? Früher sagte man dann einfach: ´Liebe Schüler`. Heute ist das nicht mehr so normal. Deutsch hat viele Optionen die Genderdiversität auszudrücken. Wenn eine Schuldirektorin eine Rede mit ´Liebe Jury, liebe Lehrer und Schüler` beginnt, ist das problematisch. Es ist nicht klar, ob ihre Rede auch für Lehrerinnen oder nicht-binäre Schüler (Schüler_innen) ist. Sie kann aber nach ´Schüler` eine Mini-Pause machen und dann ´innen` sagen. So ist klar: Sie meint Schüler und Lehrer aller Gender.“ Der Text tut so, als könnten sich die Deutschen ohne Gendersprache nicht mehr richtig verständigen. Kein Wort darüber, dass in der Grammatik des Deutschen ein generisches Maskulinum existiert, das Personen beiderlei Geschlechts einschließt und das die Deutschen bis auf eine kleine Minderheit automatisch benutzen. Da das Goethe-Institut aus dem Bundeshaushalt finanziert wird, macht sich der Deutsche Bundestag an dieser kläglichen sprachlichen Außendarstellung unseres Landes mitschuldig. In Frankreich gibt es die Académie française, die streng und unbestechlich über die Vereinheitlichung und Pflege der französischen Sprache wacht. In Deutschland ist der Rat für deutsche Rechtschreibung ein zahnloser Tiger, dem selbst das deutsche Parlament auf der Nase herumtanzt. Für eine Institution, die nach unserem größten Dichter, Goethe, benannt wurde, ist diese Art der Genderpropaganda peinlich.
Sollen Ausländer auch gendern?
Wenn es um die Propagierung der Gendersprache geht, darf die Bundeszentrale für politische Bildung nicht fehlen. In einem Meinungsbeitrag schreibt eine Referentin: „Aus sprachdidaktischer Sicht gibt es für den Kontext des Deutschlernens keinen Grund, gendergerechte Sprachverwendung nicht auch als Lerngegenstand anzusehen und zu etablieren.“ Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Deutsch als Fremdsprache (DaF) sind Lehr- und Lernprogramme für Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen und die deutsche Sprache lernen wollen. Man sollte annehmen, dass für ausländische Lerner die deutsche Hochsprache das oberste Lernziel darstellt. Wie uns die Referentin belehrt, sollen sie aber auch die Gendersprache lernen. Denn: „Das Ziel gendergerechter Sprache ist es unter anderem, die Trennung von Sprachsystem und Sprachgebrauch zu durchbrechen und sprachliches Handeln als Teil der (Re-)Produktion von gesellschaftlichen Strukturen anzusehen.“ Im Klartext heißt das: Die Spracherziehung der ausländischen Lerner soll in den Dienst der Gesellschaftsveränderung gestellt werden. Die Sprache soll als Vehikel dienen, patriarchalische Strukturen zu unterlaufen. Hier sollte man sich den Auftrag dieser Bundesbehörde in Erinnerung rufen: „Die Bundeszentrale hat die Aufgabe, durch Maßnahmen der politischen Bildung Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken.“Von einer gesellschaftsverändernden Mission ist nicht die Rede. Vermutlich haben sich, wie es häufig in nachgeordneten Behörden der Fall ist, übermotivierte „Partisanen im Apparat“ verselbständigt und verfolgen jetzt ihre eigene Mission.
Einsichtige Schulbuchverlage
Einsichtiger zeigen sich die kommerziellen Schulbuchverlage, die Lernmaterial für DaF und DaZ herstellen. Beim Klett-Verlag heißt es: „Da wir bei den Lehr- und Lernmedien besonders unsere fremdsprachlichen Zielgruppen berücksichtigen müssen, versuchen wir, nicht laut lesbare Formen wie Unterstrich, Sternchen, Binnen-I oder Gendergap zu vermeiden, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten“. Der Cornelsen-Verlag schreibt in einer Mitteilung, er fühle sich an die amtliche Rechtschreibung des Deutschen gebunden und verzichte deshalb auf Genderformen. Die Volkshochschulen, die ebenfalls Sprachkurse für Ausländer anbieten, verwenden als Zugeständnis an die Gendersprache allenfalls die eingespielten Doppelbezeichnungen wie „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“. Verlage und Volkshochschulen haben erkannt, dass man Ausländern keinen Gefallen tut, wenn man ihnen eine Sprachform beibringt, die sie in den meisten schriftlichen Erzeugnissen nicht vorfinden – schon gar nicht in unserer klassischen Literatur.
Blindenverband gleichfalls skeptisch
Das Präsidium des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) hat sich zur Gendersprache positioniert. In der Stellungnahme heißt es: „Gendern durch Sonderzeichen und Typografie (Beispiele: Mitarbeiter_innen, Mitarbeiter/-innen, MitarbeiterInnen, Mitarbeiter*innen, Mitarbeiter:innen) ist für viele blinde und sehbehinderte Menschen problematisch und deshalb nicht zu empfehlen. Der Grund liegt darin, dass sich die Sonderzeichen der Gendersprache mit der Brailleschrift nicht darstellen lassen und dass sie auch beim Vorlesen durch Personen oder Computerprogramme nicht hörbar sind. Es ist nur schwer nachzuvollziehen, dass in einer Zeit, in der wir alle physischen Hürden abbauen, die die Bewegungsfreiheit von Blinden und Sehbehinderten einschränken, sprachliche Hürden errichtet werden, die aus einer Sprachform resultieren, die von keinem deutschen Parlament jemals legitimiert wurde.
Politische Korrektheit schadet Menschen mit sprachlichen Defiziten
Die Grundbildungsstudie „LEO 2018 – Leben mit geringer Literalität“, die an der Universität Hamburg durchgeführt wurde, hatte zum Ergebnis, dass in Deutschland rund 6,2 Millionen Erwachsene mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen leben. Dies entspricht etwa 12 Prozent der Bevölkerung. Hinzu kommen rund 10,6 Millionen Menschen, die fehlerhaft schreiben. Die Zahl dürfte sich durch die schulischen Defizite während der Corona-Pandemie und durch den in den letzten Jahren verstärkten Zuzug von Migranten noch erhöht haben. Diese Menschen werden infolge ihrer Defizite an der vollen gesellschaftlichen Teilhabe gehindert. Ihnen fällt es auch schwer, am Arbeitsleben teilzuhaben, weil bei den meisten beruflichen Tätigkeiten ein Minimum an Schriftlichkeit gefordert wird. Wenn man dies weiß, ist es unverständlich, dass eine kleine urbane Elite darauf beharrt, unsere gewachsene Sprache durch politisch motivierte Eingriffe zu verändern. Der Distinktionsgewinn der einen, ist die Benachteiligung der anderen. Treffend hat dies eine Grundschullehrerin in einem Leserbrief ausgedrückt, der in einer Berliner Tageszeitung zu lesen war: „Ist Gendern erfunden worden, um die Kinder der Unterschicht noch weiter zu demütigen und auszusortieren?“