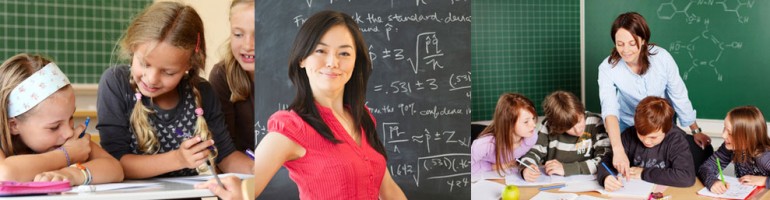Die jüngste Zuspitzung des Nahostkonflikts hat offenbart, dass unter den arabischen Bewohnern unserer Großstädte radikale Sympathisanten der Hamas leben, die selbst die brutalsten Massaker an israelischen Zivilisten bejubeln. Auch in unseren Schulen ist der Israelhass angekommen. Im Geschichtsunterricht ist es kaum noch möglich, historische Tatsachen ohne Schülerproteste zu unterrichten.
Veröffentlicht am 12. 11. 2023 auf CICERO-online
Nach dem Terrorangriff der palästinensischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gab es in deutschen Städten Sympathiebekundungen von Hamas-Sympathisanten. Besonders aggressiv traten sie in Berlin-Neukölln auf, wo Ableger der Hamas, der Hisbollah und des Islamischen Dschihad fest in der arabischen Community verankert sind. Sie brandmarkten die Vergeltungsschläge der israelischen Armee als Genozid, um die Emotionen der Muslime zu entfachen. Auch Jugendliche ließen sich von dieser Stimmung anstecken und trugen den Protest in die Schulen. Am Ernst-Abbe-Gymnasium in der Berliner Sonnenallee kam es zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Als ein 15-jähriger Schüler mit arabischen Wurzeln mit einer Palästinenserflagge auf dem Schulhof erschien, stellte sich ihm ein 61-jähriger Lehrer entgegen. Er forderte ihn auf, die Fahne in seinen Rucksack zu packen. Darauf versetzte der Schüler dem Lehrer einen Kopfstoß, woraus sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte, die erst durch das Einschreiten Dritter beendet werden konnte. Am 1. November bildeten etwa 100 Schüler dieses Gymnasiums auf der Sonnenallee einen Protestmarsch, dem sie ein Banner mit der Losung „Schulen in den Widerstand für die Freiheit Palästinas“ vorantrugen. Es ist offensichtlich, dass sich hier eine Front muslimischer Schüler unterschiedlichster nationaler Herkunft zusammengefunden hatte. Da sich in den letzten Wochen auch an anderen Berliner Schulen bei muslimischen Schülern eine aggressive Stimmung zeigte, sah sich die Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) veranlasst, in einem Rundschreiben darzulegen, wo die Grenze zwischen pädagogisch gebotenen inhaltlichen Diskussionen über den aktuellen Nahostkonflikt und der Verherrlichung von Kriegsgräueln verläuft.
Wie der Nahostkonflikt in unsere Schulen einwanderte
Als ich Mitte der 1970er Jahre meine erste Lehrerstelle antrat, war im Geschichtsunterricht die Diskussion über den Nahostkonflikt genauso störungsfrei möglich wie die Besprechung des Ersten Weltkriegs oder der Kuba-Krise. Es gab keine Gefühlsaufwallungen von Seiten muslimischer Schüler und auch keine aggressive Parteinahme für die Palästinenser. Das lag sicher daran, dass es damals in unseren Schulen kaum Schüler mit arabischen Wurzeln gab. Die große Mehrzahl muslimischer Schüler hatte eine türkische Einwanderergeschichte. Und diese entwickelten damals keine besondere Sympathie für die „palästinensische Sache“. Sie staunten sogar, als ich ihnen erzählte, dass Palästina einmal zum Osmanischen Reich gehört habe, aus dem nach dem Ersten Weltkrieg auch die moderne Türkei hervorgegangen war. Die Stimmung im Geschichtsunterricht veränderte sich schlagartig nach dem Terroranschlag von Al-Qaida auf das World-Trade-Center in New York am 11. September 2001. Der von den USA anschließend geführte „Krieg gegen den Terror“, an dem sich auch andere demokratische Staaten beteiligten, weckte bei den Muslimen eine Abwehrhaltung, die bei einer Minderheit in eine aggressive Frontstellung gegen die westliche Lebensart überging. Die Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus war geboren. Es konnte nicht ausbleiben, dass der Nahostkonflikt dem Deutungsmuster unterworfen wurde, hier kämpfe der vom Westen hochgerüstete Apartheid-Staat Israel gegen eine in Elend und Subalternität gehaltene palästinensische Bevölkerung. Die internationale Linke schloss sich dieser Deutung des Konflikts als Teil des „weltweiten antiimperialistischen Kampfes“ an. Im Geschichtsunterricht schlugen mitunter die Wogen hoch. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie muslimische Schüler im Unterricht das Israel-Heft der „Informationen zur politischen Bildung“ demonstrativ zerrissen, weil sie darin nur „israelische Propaganda“ sahen. Dabei sind diese Unterrichtsmaterialien an Ausgewogenheit der Standpunkte kaum zu übertreffen.
Schwere Zeiten für Fakten
Selbst im Oberstufenunterricht war es nur schwer möglich, unumstößliche Fakten störungsfrei zu vermitteln. Die Heißsporne unter den Schülern wollten sich ihr Weltbild, an dem ihre Identität hing, nicht zerstören lassen. Ich ließ nichts unversucht. Ich lud einen Professor für Orientalistik in meinen Unterricht ein. Er erklärte den Schülern die komplizierte Siedlungsgeschichte in dem Gebiet, das wir heute Palästina nennen. 1000 vor Chr. habe der Jude David, den wir aus dem Alten Testament der Bibel kennen, aus den zwölf jüdischen Stämmen ein Königreich geformt und Jerusalem zu dessen Hauptstadt gemacht. Einer der Stämme trug den Namen Israel. Er stand bei der Benennung des jungen Staates Israel bei seiner Gründung im Mai 1948 Pate. Arabische Siedlungen habe es in der Frühzeit Palästinas auch schon gegeben. Die meisten der heutigen arabischen Bewohner seien allerdings erst im 19. Jahrhundert eingewandert, weil sie dem Bevölkerungsdruck in den Nachbarländern entgehen wollten. Die heutigen Israelis setzen sich aus den Nachfahren des ehemaligen jüdischen Königreichs und aus Zuwanderern zusammen, die ab Ende des 19. Jahrhunderts vor allem aus osteuropäischen Ländern eingewandert waren. Nachdem der 1. Zionistische Weltkongress in Basel (1897) die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina beschlossen hatte, verstärkte sich der Zustrom von Juden enorm. Für meine arabischen Schüler waren diese Informationen nur schwer zu ertragen. Sie unterbrachen den Referenten mehrfach, indem sie ihn der Lüge bezichtigten. Sie hatten erkannt, dass diese Informationen das von den palästinensischen Organisationen verbreitete Narrativ, die Araber seien seit Urzeiten die einzig legitimen Einwohner Palästinas, in Frage stellten. Mir wurde klar, dass die Sichtweise, die diese Schüler auf den Nahostkonflikt hatten, so tief verwurzelt und emotional so stark aufgeladen war, dass ihr mit der Präsentation von Tatsachen kaum beizukommen war.
Häme über den Holocaust
Eine neue Qualität erreichten die Auseinandersetzungen im Geschichtsunterricht nach dem Gaza-Krieg im Sommer 2014. Die Entführung und Ermordung von drei israelischen Teenagern durch die Hamas hatte zu einem siebenwöchigen Krieg geführt, in dem mehr als 2.100 Palästinenser im Gazastreifen und 73 Israelis getötet wurden, darunter 67 Soldaten. Der Krieg wurde auch in den sozialen Medien geführt. Schüler tauschten Videos aus, die die vermeintlichen Gräuel der israelischen Armee in Gaza zeigen sollten. Dass die Hamas den Krieg ausgelöst hatte, spielte für die parteiischen Schüler keine Rolle. Damals wurde der Slogan „Kindermörder Israel“ geboren. Auch im Unterricht erreichte der Israelhass eine neue Qualität. Als ich in der 9. Klasse den Holocaust unterrichtete, erntete ich hämische Kommentare von Seiten arabischer Schüler: „Geschieht den Juden recht“ und „Das müsste man wiederholen“. Ich habe Lehrkräfte erlebt, die aus Erschütterung über solche Kommentare den Holocaust im Unterricht nie mehr besprochen haben. Die Verächtlichmachung des Holocaust-Gedenkens, dem sich Deutschland aus historischer Verantwortung verschrieben hat, folgt einer simplen Logik. Arabische Schüler wissen, dass die bedingungslose Solidarität der deutschen Regierung mit Israel aus der historischen Schuld resultiert, die unser Land mit der Shoa auf sich geladen hat. Wenn es gelänge, die Erinnerungskultur zu erschüttern, geriete auch unsere Solidarität mit dem Staat Israel ins Wanken. Ich habe aber auch muslimische Schüler erlebt, die den Holocaust leugneten. Sie erzählten in der Klasse, die Juden hätten die Shoa erfunden, um weltweit Mitleid zu erregen und dadurch „ihre eigenen Verbrechen am palästinensischen Volk“ zu kaschieren. Auch die Logik dieser Argumentation ist leicht durchschaubar: Wenn es den Holocaust gar nicht gegeben hat, sind die Palästinenser die einzigen legitimen Opfer im Nahostkonflikt.
Planspiel Staatsgründung
Planspiele im Geschichtsunterricht durchzuführen, ist eine sehr wirkungsvolle Methode, um Schülern historische Handlungsoptionen vor Augen zu führen. Da ich wusste, dass meine Schüler über die Gründung des Staates Israel keinerlei Vorkenntnisse hatten, entwickelte ich dazu folgendes Planspiel: „Die Vereinten Nationen möchten den Konflikt zwischen Arabern und Juden in Palästina schlichten und eine Lösung für ein friedliches Zusammenleben finden. Wie könnte sie aussehen?“ Die Mehrzahl der Schüler kam auf die Idee, beiden Gruppen die Gründung eines eigenen Staates zu ermöglichen. Frappierend war, dass sich alle Schüler eine friedliche, gut nachbarschaftliche Beziehung der beiden Staaten ausmalten. Die Staaten trieben miteinander Handel und organisierten einen sportlichen und kulturellen Austausch. Sie reduzierten sogar die Ausgaben für ihr Militär, weil kriegerische Auseinandersetzungen nicht mehr zu erwarten seien. Die Schüler entwickelten eine Utopie, die tatsächlich hätte Wirklichkeit werden können, wenn die Araber 1947 das Angebot der UN nicht ausgeschlagen hätten. Ich erzählte den Schülern, dass die Juden das Angebot akzeptierten und 1948 den Staat Israel gründeten. Unbegreiflich war selbst für arabische Schüler, warum die Palästinenser, die heute lautstark einen eigenen Staat fordern, einen solchen damals ablehnten. Sie konnten sich einen solchen historischen Fehler nicht erklären. Aus historischen Dokumenten erarbeiten wir den Grund: Die palästinensischen Führer waren der Meinung, dass ihnen ganz Palästina zustehe. Für einen israelischen Staat war in ihrem Denken kein Platz. Das ist der Grund, weshalb Israel seine Unabhängigkeit in mehreren ihm von den arabischen Nachbarstaaten aufgezwungenen Kriegen verteidigen musste. Israel ist der einzige Staat aller 193 Staaten der Vereinten Nationen, dem das Existenzrecht von anderen UN-Mitgliedsstaaten bis heute abgesprochen wird. Die palästinensischen Autoritäten haben sich bis heute nicht zu ihrem damaligen Versagen bekannt. Stattdessen schüren sie die Illusion, sie könnten Israel mit Gewalt auslöschen, um das ganze Land in Besitz zu nehmen.
Antisemitische Ressentiments von links
Am Gymnasium, dem Ort des rationalen Diskurses, gibt es neben dem Antisemitismus muslimischer Schüler auch antijüdische Ressentiments von links. Aus dem Munde von Kindern aus bildungsbürgerlichen, linksliberalen Elternhäusern muten sich antiisraelische Affekte befremdlich an. Wenn man sich auf ihre Argumente einlässt, stößt man schnell auf den Kern ihrer feindseligen Haltung gegenüber dem Staat Israel. Sie werfen ihm vor, die Menschenrechte zu verletzen, indem er die Palästinenser in den besetzten Gebieten unterdrücke. Während arabische Schüler Israel als „Kindermörderland“ verunglimpfen, argumentieren deutsche Schüler differenzierter, weil sie wissen, dass Judenhass in Deutschland ein Tabu darstellt: „Gegen die Juden in Deutschland habe ich nichts, aber wie sich die Israelis in Palästina aufführen…“. Als der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Jahr 2012 Israel als „Apartheid-Regime“ bezeichnete, pflichteten ihm nicht wenige Schüler bei: „Endlich mal einer, der es wagt, die Wahrheit zu sagen…“.
Psychische Entlastung von der Schuld der Väter
Die Israel-Kritik deutscher Schüler hat, wie mir eine Psychologin erklärte, auch eine psychologische Komponente, die etwas mit dem Holocaust zu tun hat. Wenn junge Menschen zum ersten Mal das Grauen der Judenvernichtung in Auschwitz wahrgenommen haben, sind sie zutiefst schockiert und verunsichert. Wenn dann noch davon die Rede ist, dass dieses Menschheitsverbrechen für immer mit dem deutschen Namen verbunden sei, regt sich bei ihnen ein innerer Widerstand. Sie können es nur schwer ertragen, sich für ein singuläres Menschheitsverbrechen in Haftung genommen zu fühlen, das über 75 Jahre zurückliegt und für das sie – die dritte Generation nach dem Holocaust – nichts können. Es ist schwer, diesen jungen Menschen den Unterschied zwischen Schuld, die immer persönlicher Natur ist, und Verantwortung, die auf einem ganzen Volk lastet und nie endet, zu erklären. Das fällt umso schwerer, als es immer wieder Wortmeldungen von Politikern und Intellektuellen gibt, die von Geschichtsblindheit geprägt sind und sich auch im Ton vergreifen. Der Schriftsteller Martin Walser sprach in seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998 von der „Moralkeule Auschwitz“, die von jüdischer Seite als „jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel“ benutzt werde. Er verwahrte sich gegen die „Monumentalisierung der Schande“. Ähnliche Worte benutzte der Rechtsaußen der AfD, Björn Höcke, als er das Holocaust-Denkmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ bezeichnete. Schülern fällt es schwer, die Singularität der deutschen Schuld zu akzeptieren, weil dies ihre patriotischen Gefühle verletzt. Zur Entlastung zählen sie dann gerne die Verbrechen auf, die auf dem Schuldkonto anderer Nationen lasten: Weiße Einwanderer hätten die Indianer Amerikas ausgerottet, Engländer im Kolonialkrieg Gräuel begangen, Russen das grausame Gulag-System erfunden. Von Kindern kennt man die Ausrede, wenn sie bei etwas Unrechtem ertappt werden: „Aber der Ronny hat auch…“ – Psychologen nennen diesen Mechanismus Schuldentlastung durch Schuldzuweisung. Gerade Schüler mit einem großen Gerechtigkeitsempfinden neigen dazu, die Verbrechen der Weltgeschichte gerecht unter den Nationen aufzuteilen. Ich glaube nicht, dass die jungen Menschen mit linksbürgerlicher Prägung, die heute im Unterricht Israel kritisieren, genuin antisemitische Gefühle hegen. Dazu sind sie in Habitus und persönlichem Umgang viel zu weltoffen und tolerant. Ihre Kritik an den Juden gilt dem Staat, der als Wiedergutmachung für die versuchte Auslöschung des jüdischen Volkes entstanden ist. Die leidvolle Existenz des Staates Israel ist für sie der Stachel, der die Erinnerung an deutsche Verbrechen ewig wachhält. Das erklärt auch den Slogan „Befreit Palästina von der deutschen Schuld“, den linke Studenten gerne benutzen. Dass sie dabei die Schuldkult-Kritik der Rechten kopieren, ficht sie nicht an.
Versagen eines Schulleiters
2017 ereignete sich in der Gemeinschaftsschule in Berlin-Friedenau ein krasser Fall von Antisemitismus. Ein 14-jähriger jüdischer Junge wurde von muslimischen Mitschülern wegen seiner Religionszugehörigkeit vier Monate lang so heftig gemobbt und körperlich attackiert, dass er die Schule für immer verließ. Die aggressiven Schüler machten ihn für die Politik Israels gegenüber den Palästinensern verantwortlich, als sie zu ihm sagten: „Juden sind alle Mörder“. Um die Bösartigkeit dieser Beleidigung zu erfassen, muss man wissen, dass die Großeltern des Schülers den Holocaust überlebt haben und wieder in Berlin leben. Der Vater des Schülers machte der Schulleitung schwere Vorwürfe: „Die Schulleitung hat überhaupt nicht reagiert. Wir haben ja nicht einmal einen Termin für ein Gespräch bekommen, obwohl das Mobbing sofort losging, als unser Sohn (…) in die Schule kam.“ Bei vielen Schulleitern hat sich die Haltung eingeschlichen, Mobbingfälle an der eigenen Schule unbedingt unter den Teppich kehren zu wollen. Die Lehrkräfte werden zum Schweigen verpflichtet, damit der Ruf der Schule nicht leidet, wenn die unliebsamen Vorfälle an die Öffentlichkeit dringen. Einer solchen Vertuschungstaktik sollten die Kultusminister einen Riegel vorschieben. Die Schulleitungen sollten verpflichtet werden, alle Vorfälle, die etwas mit der ethnischen oder religiösen Diskriminierung von Schülern zu tun haben, zu melden. Für rassistisch begründete Übergriffe haben die Bundesländer Meldeportale geschaffen. Antisemitische Vorfälle kann man gesondert bei den „Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus“ (Rias) melden. Problematisch reagierten die Eltern der Friedenauer Gemeinschaftsschule. Sie beklagten die ihrer Meinung nach „einseitige Art der Berichterstattung“, die sich „nachhaltig rufschädigend für eine äußerst engagierte Schule auswirkt.“ Hätte der Schulleiter den Vorfall also doch verschweigen sollen? Die verstörende Pointe der Geschichte: Die Friedenauer Gemeinschaftsschule gehört seit 2016 zum Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Einen schlechteren Start in eine diskriminierungsfreie Schule hätte es für sie nicht geben können.
An den gymnasialen Tugenden festhalten
Was tun? Als Pädagoge darf man die Flinte nie vorschnell ins Korn werfen. Für sachliche Aufklärung und rationale Argumentation im Unterricht gibt es keine Alternative. Geschichtslegenden sollten die Lehrkräfte mit historischen Tatsachen begegnen. Der Ausgrenzung missliebiger Schüler müssen sie Einhalt gebieten, indem sie auf die humanistische Grundlage unserer freiheitlichen Ordnung verweisen. In schwerwiegenden Fällen hilft das Disziplinarrecht. Lehrkräfte sollten nicht resignieren, sondern auf die Wirksamkeit der gymnasialen Lernkultur vertrauen. Ich hatte in der Vergangenheit in meinen Abiturkursen heftige Debatten mit Hausbesetzern, Greenpeace-Aktivisten, Linksautonomen und Klima-Rebellen zu bestehen und habe es als Erfolg verbucht, wenn sie schließlich einsahen, dass Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele selten zum Erfolg führt. Auch internationale Konflikte wurden schließlich friedlich beigelegt, weil die Kontrahenten nach mehreren Kriegen zu der Erkenntnis gelangt waren, dass die Gewaltspirale den Menschen nur Unglück gebracht hat. Am Beispiel der deutsch-französischen Freundschaft können auch arabische Schüler lernen, wie zwei Erzfeinde, die sich in vier Kriegen bekämpft haben, schließlich zu Freunden geworden sind.