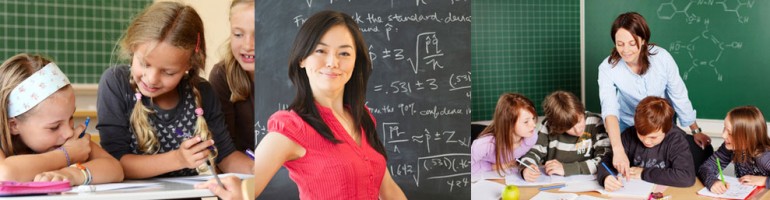Veröffentlicht in „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Bildungswelten)
06. 04. 2017
Am 4. Mai 2017 werden sich in 400 Berliner Grundschulen 28.000 Schüler der dritten Klassen über ein Aufgabenblatt beugen, das ihnen eine einheitliche Schreibaufgabe abverlangt. An diesem Tag findet der landesweite Test „VERA 3“ im Fach Deutsch statt. Schüler und Eltern werden der Veröffentlichung der Ergebnisse mit Interesse entgegensehen. Die Berliner Schulverwaltung wird diesen Tag eher mit Bangen erwarten. Die Besorgnis hat gute Gründe. Beim „VERA 3“-Test im Schuljahr 2014/2015 waren die Ergebnisse für die Berliner Grundschüler verheerend. Die Hälfte der Drittklässler erfüllte nicht die Mindestanforderungen an die Rechtschreibung, die die Kultusministerkonferenz (KMK) festgelegt hatte. Sie können, wie es im Kommentar des Instituts für Schulqualität (ISQ) hieß, gerade einmal „lautgetreu“ schreiben. Im Klartext heißt das: Die Schüler bringen Wörter so zu Papier, wie sie sie hören, nicht aber, wie sie korrekt geschrieben werden. Auch in den Folgejahren verbessern sich die Schreibleistungen der Schüler nicht, wie die schlechten Ergebnisse beim Deutsch-Test „VERA 8“ belegen.
Man kann vermuten, dass viele Lehrer in der Grundschule die Lernmethode verwenden, die im Ruf steht, besonders schülerfreundlich zu sein, weil sie es den Schülern ermöglicht, frisch darauf loszuschreiben, ohne sich vorerst um Regeln der Orthografie kümmern zu müssen. Es ist die umstrittene Methode „Schreiben nach Gehör“. Die Schüler schreiben phonetisch, also so, wie sie die Wörter hören. Der dabei entstehende Text-Kauderwelsch ist oft nur schwer verständlich: „Di foirwer retete eine oile aus dem Stal.“ Linguistik-Experten haben vor diesem Verfahren schon immer gewarnt, weil es in den Köpfen der Kinder die falsche Schreibweise zuerst verfestige, die man dann wieder mühsam dem regelgerechten Schreiben anpassen müsse – ein unsinniger Umweg. In Internetforen bezeichnen Eltern die Didaktik „Schreiben nach Gehör“, die an ihren Kindern ausprobiert wird, als „unterlassene Hilfeleistung“.
Die beiden klassischen Lernmethoden beim Schriftspracherwerb, die silbenanalytische (die Silbe dient als Grundlage der Wortbildung) und die analytisch-synthetische (sie lehrt die korrekte Laut-Buchstaben-Zuordnung), sind der phonetischen Methode deutlich überlegen. Vor allem bei der silbenanalytischen Methode zeigen sich, wie Studien belegen, schon im zweiten Schuljahr beim Lesen und Schreiben sehr gute Resultate. Eine Unterrichtsdidaktik sollte sich eigentlich am zu erzielenden Resultat ausrichten und nicht an psychologischen Kriterien, wie den vermeintlichen Schreibbarrieren der Schüler. Wenn eine Erleichterungsdidaktik zu Misserfolgen führt, dient sie nicht dem Kind. Sie sollte deshalb schleunigst korrigiert werden.
Es verblüfft einen immer wieder, wenn man Briefe von Menschen liest, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts zur Schule gegangen sind. Sie schreiben in einem nahezu fehlerfreien Deutsch. Dabei haben sie oft nur die 8-klassige „Volksschule“ besucht. Ihr korrektes Deutsch haben sie gelernt, weil das Üben der Rechtschreibung mit einer Beharrlichkeit durchgeführt wurde, die „schülerzugewandte“ Pädagogen heute als unmenschlichen Drill stigmatisieren. Vermutlich haben die Didaktiker der alten Zeit mehr von der Beschaffenheit unseres Gehirns gewusst, als wir ihnen aus heutiger Sicht zugestehen wollen. Die physiologische Gehirnforschung vertritt nämlich die Ansicht, dass unsere Merkfähigkeit vor allem durch beständiges Üben gestärkt wird. Warum sollte man das Drill nennen, was uns das eigene Gehirn als eine erfolgversprechende Lernmethode vorgibt? Es ist an der Zeit, dass sich die Lehrer gegen die unwissenschaftliche Verächtlichmachung des Übens verwahren.
Um die Ursachen für die schlechten Rechtschreibleistungen der Berliner Grundschüler zu ergründen, lohnt sich auch ein Blick in den gültigen Rahmenlehrplan Deutsch (2015). Obwohl sich in Berlin inzwischen im Schulsystem ein Zweisäulenmodell etabliert hat, beharrt der Senat darauf, allen Schulformen von Klasse 1 bis 10 einen einheitlichen Lehrplan zu verordnen. Vom Eigenwert gymnasialen Lernens ist nirgendwo die Rede. Bei der Lektüre des Plans springt sofort ins Auge, dass der Mündlichkeit gegenüber dem Schreiben ein unverhältnismäßig großer Stellenwert eingeräumt wird. Das ist nur schwer nachzuvollziehen, da das Schreiben doch die Fertigkeit ist, die die Schüler an der Grundschule neu lernen sollen. Den mündlichen Sprachgebrauch bringen sie hingegen – mehr oder weniger gut ausgeprägt – mit. Ich habe mich als Lehrer oft gewundert, warum Schüler, die im Unterrichtsgespräch gute Beiträge lieferten, bei ihren schriftlichen Ausführungen versagten. Zwischen Eloquenz und Schreibfertigkeit klaffte eine Lücke, die nur so zu erklären ist, dass der tägliche Unterricht das, was die Schüler schon können, nämlich sich mündlich flüssig zu äußern, in einer Endlosschleife immer weiter verstärkt. Das mühselige Geschäft, die Schreibfähigkeit zu entwickeln, wird von Lehrern um des lieben Friedens in der Klasse willen gerne vernachlässigt.
Der Grammatik des Deutschen wird im Rahmenlehrplan Deutsch keine eigene Abteilung zugestanden. Sie wird unter „Rechtschreibung“ subsummiert, was eine problematische Verengung bedeutet. Ein Lernziel lautet: „[Die Schüler sollen] ihr grammatisches Wissen zur Identifikation von Fehlerschwerpunkten nutzen“. Die Grammatik hat also lediglich eine dienende Funktion zur Vermeidung von Rechtschreibfehlern, wird aber nicht als in sich logisches System verstanden und gelehrt. Folgerichtig ist, dass zwei wesentliche Begriffe der Grammatik, Syntax und Semantik, im Lehrplan gar nicht vorkommen. Wie sollen Schüler aber stimmige Texte schreiben, wenn sie in der Satz- und Bedeutungslehre gar nicht unterrichtet worden sind. Müssen die Gymnasiasten darunter leiden, dass der Rahmenlehrplan aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit das gymnasiale Niveau nicht mehr gesondert ausweisen darf?
Die Schulbuchverlage sind dem modischen Trend, die Grammatik in anderen Themenfeldern aufgehen zu lassen, gefolgt. In den Deutschbüchern gibt es deshalb keinen eigenständigen Grammatikteil mehr. Grammatische Phänomene werden beiläufig bei der Interpretation literarischer Texte abgehandelt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass alles, was als „beiläufig“ deklariert wird, auch so behandelt wird: nämlich eher nachlässig. Daran kann auch der euphemistische Begriff des „verbundenen Grammatikunterrichts“ nichts ändern. Ich habe am Gymnasium immer reine Grammatikstunden gehalten. Mal standen die Satzglieder auf dem Programm, mal die Gliedsatzarten oder der Konjunktiv. Kein Schüler hat solche Stunden je als geistlose Abrichtung empfunden. Im Gegenteil. Es gab immer Schüler, denen es eine intellektuelle Freude bereitete, in die Geheimnisse der deutschen Grammatik einzudringen. Sie entwickelten einen sportlichen Ehrgeiz, ein Präpositionales Objekt von einer Adverbialen Bestimmung zu unterscheiden. Das sind doch Sternstunden des Deutschunterrichts.
Wenn schon der Verzicht auf einen eigenständigen Grammatikunterricht die Gymnasialschüler unterfordert, tut es eine Prüfung in ganz besonderem Maße: die zum Mittleren Schulabschluss (MSA). In Deutsch besteht sie aus der Beantwortung von Lesefragen nach dem Multiple-Choice-Prinzip. Beispiel: „Kreuze die richtige Lösung an. In dem Text geht es hauptsächlich um…“. Dann folgen vier Kästchen. Das Multiple-Choice-Verfahren bei der Textinterpretation ist ein Relikt aus den 1960er Jahren. Im Deutschunterricht der Gesamtschulen hat man es eingeführt, um Nachteile für Kinder aus Unterschichtfamilien, die beim Schreiben nur über einen „restringierten Code“ verfügen, gegenüber den „elaboriert“ schreibenden Kindern aus der Mittelschicht auszugleichen. Bald kam man von diesem soziolinguistischen Postulat wieder ab, weil man erkannte, dass das Ankreuzen von Kästchen die Entwicklung einer Schreibkompetenz eher behindert. Schreiben kann man nur lernen, wenn man schreibt und wenn man das Schreiben beharrlich und bei jeder Gelegenheit übt. Mustergültig sind die Deutsch-Prüfungsaufgaben in Bayern, weil sie den Schülern in allen Schulformen einen zusammenhängenden Text abverlangen.
An Berlins Gymnasien sollte die MSA-Prüfung ganz abgeschafft werden, weil fast alle Schüler sie bestehen. Gymnasiasten vorformulierte Antworten ankreuzen zu lassen, kann man durchaus als Zumutung empfinden. Die für die MSA-Prüfung aufgewandte Zeit könnte man sinnvoller für die Einübung von Arbeitsweisen der Gymnasialen Oberstufe verwenden. Dies scheint gerade in Berlin, wo der gymnasiale Bildungsgang nur sechs Schuljahre umfasst, dringend geboten.
Wie kann man die Schreibmisere bei Berlins Schülern beheben? Der Senat von Berlin sollte den Rahmenlehrplan Deutsch 1-10 grundlegend überarbeiten. Das Gymnasium muss dabei ein eigenes Leistungsprofil erhalten, das der Besonderheit gymnasialen Lernens gerecht wird. In Grundschule, Sekundarschule und Gymnasium muss der Schriftlichkeit höchste Priorität eingeräumt werden. Dabei sollten den Scharnierstellen der schulischen Laufbahn – Klasse 4, Klasse 6 und Klasse 10 – verbindliche Standards des schriftlichen Sprachgebrauchs zugeordnet werden. Sie müssten in altersgerechter Steigerung die Schreibformen umfassen, die für die geistige Arbeit im Fach Deutsch unverzichtbar sind: Inhaltsangabe, Textanalyse und Erörterung. Jede Lehrkraft sollte verpflichtet werden, diese Schreibformen im Unterricht verbindlich und beharrlich einzuüben. Was auf dem Spiele steht, hat der Sprachforscher Christian Lehmann deutlich formuliert: „Wegen ihres Bildungscharakters hat Schriftsprache in allen Gesellschaften mit einer traditionellen Schriftkultur einen höheren Wert als die gesprochene Sprache“.