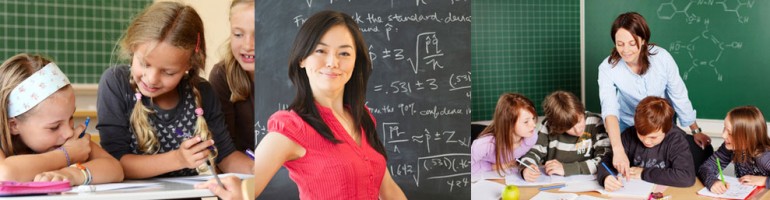| Vortrag im Rahmen des Humboldt-Gedenkens am 16. März 2017, Humboldt-Gymnasium Berlin-Tegel |
Das Bildungskonzept Wilhelm von Humboldts
„Bienen haben Vorfahrt“
Im Jahre 1989 kam ich als Lehrer an das reformpädagogisch geprägte Internatsgymnasium Schulfarm Scharfenberg. Schon in der vierten Woche hatte ich eine überraschende Begegnung mit dem ganzheitlichen Bildungskonzept der Schule. Für einen erkrankten Kollegen hatte ich eine Klausur zu beaufsichtigen. Mitten in der Stunde schrillte ein hohe Klingel. Drei Schüler sprangen auf und verließen fluchtartig den Raum. Ich fragte die anderen Schüler, was hier los sei. Eine Schülerin klärte mich auf: Dies sei die Imker-Klingel gewesen. Bestimmt sei ein Bienenvolk ausgeschwärmt und müsse jetzt von den Schülern der Imkerei wieder eingefangen werden. Nach der Klausur fragte ich etwas indigniert den Schulleiter, ob das rechtens sei, dass die Schüler mitten in der Klausur den Raum verlassen – wegen der Bienen. Er meinte schmunzelnd: „Lieber Kollege, an eines müssen Sie sich gewöhnen. An unserer Schule haben die Bienen Vorfahrt.“ – Dieser Vorfall war für mich eine Art von Paulus-Erlebnis in Bezug auf die Reformpädagogik. Ich lernte das Engagement der Schüler außerhalb des Unterrichts schätzen, weil ich sah, mit welcher Begeisterung und Verantwortung sie ihre Aufgaben in den Werkstätten, die wir altertümelnd „Innungen“ nannten, wahrnahmen und wie sie dabei in ihrer Persönlichkeit reiften.
Sie werden fragen, was diese Episode mit dem Erziehungskonzept Wilhelm von Humboldts zu tun hat. Eine ganze Menge. Von ihm stammt nämlich der Satz: „Auch Griechisch gelernt zu haben, könnte dem Tischler ebenso wenig unnütz seyn, als Tische zu machen dem Gelehrten.“
Wie man an dem Zitat sehen kann, versteht W. v. Humboldt unter Bildung nicht in erster Linie Ausbildung für einen Beruf, sondern die allseitige Vervollkommnung des Menschen, heute würden wir sagen: Persönlichkeitsbildung.
Wilhelm von Humboldt hat als Kind nie eine Schule von innen gesehen. Zusammen mit seinem Bruder Alexander wird er von hochgebildeten Persönlichkeiten privat im elterlichen Schloss in Tegel unterrichtet und auf das Studium vorbereitet. Sein erster Lehrer war Johann Heinrich Campe, ein Vertreter der philanthropischen Pädagogik. Diese Spielart der Pädagogik will der Erziehung und Bildung junger Menschen neue Wege im Geiste der Aufklärung eröffnen. Mit Campe unternimmt Wilhelm von Humboldt 1789 eine Bildungsreise nach Paris und erlebt hautnah die Französischen Revolution.
Wilhelm von Humboldt ist einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit. Er ist bewandert in Geschichte, Politik und Diplomatie, vor allem aber in den Sprachen. Viel profitiert er von den Vorlesungen des berühmten Göttinger Philologen und Altertumsforscher Christian Gottlob Heyne. Humboldt beherrscht Französisch, Englisch, Italienisch, Latein und Griechisch in Wort und Schrift. Seine Sprachleidenschaft ist so groß, dass er immer wieder neue Sprachen auf ihre grammatische Struktur untersucht, so das Baskische, das Sanskrit und die Südseesprache Kawi. Dabei gilt sein besonderes Interesse der Frage, wie die Sprache das Denken der Menschen und ihre Kultur beeinflusst.
Man könnte es als Ironie der Bildungsgeschichte bezeichnen, dass der privilegierte Privatschüler Humboldt später zum wohl einflussreichsten Bildungsminister in der deutschen Geschichte werden sollte, der die staatliche Schul- und Hochschulpolitik in völlig neue Bahnen lenkte.
Wilhelm von Humboldt hat schon früh eine präzise Vorstellung davon, wozu Bildung dienen soll. Schon als 25-Jähriger beschreibt er dieses Ziel in seiner staatspolitischen Schrift „Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen“ so:
„Der wahre Zweck des Menschen ist die höchste und proportionierlichste [also: alles einbeziehende] Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen.“
Ganzheitlichkeit ist für ihn ein Wesensmerkmal des erzieherischen Einwirkens auf das Kind. Nur die Weckung aller Sinne des Kindes könne die seelisch-geistige Harmonie bewirken, die ihm als menschlichem Wesen zukommt. Alles Wissen, das das Kind im Bildungsprozess erwirbt, diene dazu, seine Person zu bereichern, seinem Welt- und Selbstverständnis neue Dimensionen zu erschließen. Bildung müsse deshalb Allgemeinbildung sein, weil nur so alle Interessen und Neigungen eines Kindes befriedigt werden können. Schulische Bildung solle sich deshalb nicht zu früh in Spezialisierungen verlieren, nicht zu früh durch Zwecksetzungen gesellschaftlicher Art von der „wahren Menschenbildung“ – so Humboldt – abgelenkt werden.
Was sind die geistigen Grundlagen von Humboldts Bildungsbegriff?
Wilhelm von Humboldt ist ein Kind der Aufklärung. Schon als junger Mensch verkehrt er im Bildungsmilieu der Berliner Aufklärung, besucht regelmäßig den Salon von Marcus und Henriette Herz, in dem alle wichtigen Köpfe der Berliner Aufklärung aus- und eingehen. Gemeinsam lesen und diskutieren sie die Schriften von Immanuel Kant, des wichtigsten Philosophen der Aufklärung in Deutschland. Bei Kant lernt Humboldt das Prinzip der Ganzheit kennen, das dieser in seiner Schrift „Kritik der Urteilskraft“ (1790) formuliert hat. Kants Ziel ist die Ausarbeitung einer Philosophie des Lebens, der Versuch, den Menschen als „ein Ganzes nach den Zwecken der Vernunft architektonisch zu entwerfen“. Aus dieser Idee leitet Humboldt die Vorstellung ab, dass die universelle Bestimmung eines jeden Menschen darin bestehe, durch Bildung die „Idee der Menschheit“ – so Kant – zu verwirklichen. Allgemeine Menschenbildung bedeute deshalb, die Verknüpfung „unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung“.
Es ist nicht zu übersehen, dass sich Humboldt hier am Ideal der griechischen Antike orientiert. Im griechischen Menschen sieht er das Ideal der ganzheitlichen Vervollkommnung, die Einheit von Körper und Geist, von Natur und Kultur, am besten verwirklicht. Die „Bildung des schönen menschlichen Charakters“ (Humboldt) sei nur durch die weitestgehende Annäherung an das griechische Ideal möglich. Deshalb ist es für ihn selbstverständlich, dass sich die Schüler am humanistischen Gymnasium intensiv mit den antiken Sprachen Griechisch und Latein und mit der Kultur der Antike auseinandersetzen.
In Göttingen besucht Wilhelm von Humboldt zusammen mit seinem Bruder Alexander die Vorlesungen des Professors für Anatomie Johann Friedrich Blumenbach. Dieser vertritt die Theorie, dass allem organischen Leben ein „Bildungstrieb“ (lat. „nisus formativus“) innewohne, der die Naturwesen, ob Pflanze oder Tier, zu den Geschöpfen werden lässt, an deren Anblick wir uns erfreuen. Wilhelm von Humboldt überträgt nun die Theorie vom Bildungstrieb als Naturanlage auf den Menschen, indem er auch ihm einen „Trieb zur Bildung“ unterstellt. Ausgehend von diesem Bildungstrieb entwirft er schon als 24-Jähriger in einem Brief an seinen Freund Georg Forster seine grundlegende Bildungsidee: „Der wahren Moral erstes Gesetz ist: Bilde dich selbst und nur ihr zweites: wirke auf andere durch das, was du bist“. (1791) Sich zu bilden ist für Humboldt das grundlegende moralische Gebot des aufgeklärten Menschen. Auch mit diesem Postulat ist Humboldt hoch aktuell: All diejenigen, die Bildung für ein elementares Menschenrecht halten, das keinem Kind verwehrt werden darf, können sich auf Wilhelm von Humboldt berufen.
Geistige Anregungen erhält Humboldt auch durch seine Freundschaft mit Friedrich Schiller. Er teilt Schillers Vorstellung vom wahrhaft Individuellen im Menschen, seiner Schöpferkraft, die sich in der Sprache objektiviert. Auch von Schillers Werken empfängt Humboldt wichtige Anregungen. In seiner Auseinandersetzung mit dem Drama „Wallenstein“ formuliert Humboldt erstmals seine Ideen zur Sprache. In diesem berühmten „Wallenstein“ – Brief hat man zu Recht die ‘Geburtsurkunde‘ der humboldtschen Sprachphilosophie gesehen.
Humboldt ist der Meinung, dass eine religiös-konfessionell begründete Bildung dem Primat der Vernunft entgegensteht. Seine Bildungsreform verbannt deshalb die Geistlichkeit aus dem staatlichen Lehrberuf und begründet eine rein weltliche Lehrerausbildung, die er „Pädagogische Kandidatur“ nennt. Zum ersten Mal gibt es jetzt in Deutschland rein weltliche Lehrer und eine staatliche Ausbildung des Lehrpersonals.
Mit der Einführung des Abiturexamens will Humboldt den Zustrom der Schüler zu den Universitäten kanalisieren. Das Abitur soll sicher stellen, dass nur studierfähige Schüler zum Studium zugelassen werden. Deshalb heißt die Prüfung auch Reifeprüfung (lat.: „matura“). Humboldt gibt auch eine Definition dieser „Reife“: „Der Schüler ist reif, wenn er so viel bei andern gelernt hat, dass er nun für sich selber zu lernen im Stande ist.“ Die Rolle des Lehrers besteht also darin, sich sukzessiv überflüssig zu machen.
Von der hier beschriebenen Funktion hat sich das heutige Abitur ziemlich weit entfernt. Es ist zu einem Testat für 50% eines Jugendjahrgangs geworden, von denen viele Schüler gar nicht studieren, sondern in die verschiedensten Ausbildungsberufe strömen. Und selbst diejenigen, die ein Studium aufnehmen, können nicht sicher sein, ob ihr an der Oberschule erworbenes Wissen für ein Studium ausreicht. Wenn heute durchschnittlich 30% aller Studenten ihr Studium abbrechen, liegt die Vermutung nicht fern, dass das heutige Abitur nicht mehr die Gewähr dafür bietet, dass die Gymnasiasten das für ein Studium nötige geistige und methodische Rüstzeug vermittelt bekommen haben.
Wie wirkt sich die Idee der ganzheitlichen Erziehung und Bildung in der Schule aus?
Die Gründung des humanistischen Gymnasiums im Jahre 1810 durch Humboldt bahnt dem Konzept der ganzheitlichen Bildung den Weg. Persönlichkeitsbildung steht dabei an erster Stelle: „Jeder ist offenbar nur dann guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum anderen überzugehen.“
Humboldt formuliert hier eine erstaunlich moderne Idee, die in der heutigen Zeit, in der man von den Arbeitskräften Mobilität und lebenslanges Lernen verlangt, hoch aktuell ist.
Das humboldtsche Unterrichtskonzept für das Gymnasium sollte über 150 Jahre lang gültig bleiben. Bis heute genießen am klassischen Gymnasium im geistigen Kosmos des Wissens alle Fächer den gleichen Rang. Eine Fuge von Bach analysieren zu können, ist genauso wichtig, wie die Keplerschen Planetengesetze zu verstehen. Ein Bild von Rembrandt deuten zu können, besitzt den gleichen Wert wie die Interpretation eines Gedichtes von Friedrich Hölderlin. Zweckfreiheit der Bildung bedeutet immer, sich dem Eigenwert des jeweiligen Gegenstandes auszuliefern. Ein Impromptu von Schubert am Klavier zu spielen, hat seinen Zweck in sich, bedarf keiner weiteren äußeren Zweckbestimmung. Deshalb gehörten auch die „toten“ Sprachen Latein und Alt-Griechisch selbstverständlich zum Bildungskanon des Gymnasiums. Sie zu studieren, war einfach „schön“. Sie zu lernen stand noch nicht unter dem Rechtfertigungszwang gesellschaftlicher Zweckbestimmung. Von dem romantischen Dichter Jean Paul stammt das schöne Wort: „Was für die Zeit erzogen wird, das wird schlechter als die Zeit.“ – Der Dichter wusste, dass eine gute Bildung immer einen geistigen Überschuss, eine kleine utopische Verheißung über das Alltägliche hinaus enthalten muss.
Bildung wird zur Ausbildung
Die Pädagogik der Nachkriegszeit nach 1945 ist geprägt vom ökonomischen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland, für den sich die Metapher des „Wirtschaftswunders“ eingebürgert hat. Ausgelöst vom ökonomischem Erfolg und von der rasanten technischen Entwicklung gerät der ganzheitliche humanistische Bildungsbegriff immer mehr ins Hintertreffen, ja, er muss einer rationellen, funktionalen Vorstellung von Bildung weichen. „Bildungsökonomie“ wird das neue Zauberwort. Bildungspolitiker berechnen den Zusammenhang von Bildungsinvestitionen und wirtschaftlichem Wachstum. Alle Begabungsreserven der Kinder sollen ausgeschöpft werden, um sie als Qualifikationen dem ökonomischen Prozess zuzuführen. Als höhere „Schule für alle“ wird die Gesamtschule gegründet. Auch das Gymnasium gerät in den Sog der Funktionalität. Es soll nicht mehr primär den allseitig gebildeten Menschen hervorbringen, sondern seine Absolventen effektiv auf das Studium vorbereiten. Die Spezialisierung der universitären Studiengänge bildet sich im aufgefächerten Kurssystem der Gymnasialen Oberstufe ab. So gerät schulische Bildung immer mehr zur Ausbildung für den Arbeitsmarkt. Das alte Pädagogenwort „Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir“ erhält dadurch eine fragwürdige Akzentuierung.
Dieser Trend der Bildung hin zur Ausbildung dauert bis heute an und geht einher mit einem immer größeren bürokratischen Aufwand in den Schulen. Die Komplexität der heutigen staatlichen Schule, ihr überbordendes Regelwerk und die allumfassende Verrechtlichung des Pädagogischen erinnern eher an Lernfabriken denn an die pädagogischen Anstalten, die die großen Bildungsreformer von Comenius („Alles fließe aus eigenem Antrieb, Gewalt sei fern den Dingen“) über Pestalozzi („Hilf mir, es selbst zu tun!“) bis hin zu Ellen Key („Lernen vom Kinde aus“) vor Augen hatten.
Gefährdungen des gymnasialen Bildungskonzepts durch eine problematische Didaktik
Die Veröffentlichung der ersten PISA-Studie im Jahre 2001 schreckte die deutsche Öffentlichkeit auf, waren unsere Schüler doch nur im Mittelfeld aller getesteten Industriestaaten gelandet. Hektische Betriebsamkeit in den Schulbehörden war die Folge. Unseren Schulen wurde danach ein fragwürdiges didaktisches Konzept „geschenkt“: die Kompetenzorientierung des Fachunterrichts. Dahinter verbirgt sich der Anspruch, den Schülern neben den Inhalten vor allem Fertigkeiten und Techniken beizubringen, mit deren Hilfe sie dann in der Lage sein sollten, sich Stoffgebiete eigenständig zu erschließen. In den aktuellen Bildungsplänen häufen sich Kataloge voller instrumenteller Fertigkeiten: „Die Schüler können…beschreiben, darstellen, erläutern, erklären.“ […] „Sie können…gliedern, markieren, zusammenfassen.“ Die inhaltlichen Zielvorgaben in den Bildungsplänen fallen hingegen eher dürftig aus, so dass sich der Eindruck aufdrängt, das zu vermittelnde Wissen sei austauschbar und beliebig, wenn nur die jeweilige Kompetenz griffig eingeübt wird. An deutschen Schulen gibt es keinen Kanon unverzichtbarer literarischer Werke, die im Unterricht verbindlich besprochen werden müssten. Deshalb kann es passieren, das ein Schüler, wenn er Pech hat, die Schule verlässt, ohne ein Drama von Schiller oder eine Novelle von Kleist gelesen zu haben, von Goethes „Faust“ ganz zu schweigen. In Europa ist dies ein einmaliges Beispiel für kulturelle Selbstverleugnung.
Was sind Kompetenzen? Kompetenzen sind zweckgerichtete funktionale Fähigkeiten des Denkens, die Schüler befähigen sollen, Probleme zu lösen. Diese Definition zeigt schon die ganze Problematik. Denn gymnasiales Lernen bezieht sich nur zu einem Teil auf kognitive „Fähigkeiten“. Es besteht auch keineswegs nur aus „Problemlösen“ und zielt nicht allein auf „Anwendung“. Wichtige Lerninhalte der Fächer Deutsch, Musik, Kunst, Theater, Sport oder Geschichte lassen sich mit Kompetenzmustern gar nicht erfassen. Und es sind gerade die zweckfreien Gegenstände, die den Schülern ein echtes Bildungserlebnis bescheren. Womit wir wieder bei Humboldts Ganzheitsbegriff wären.
Wie sich die Kompetenzorientierung des Unterrichts in der schulischen Praxis auswirkt, kann ich Ihnen an einem persönlichen Erlebnis illustrieren. Mit einem Referendar, den ich als Mentor betreute, hatte ich einmal eine interessante Diskussion. Er fragte mich, ob ich ihm für seine Deutsch-Lehrprobe in einer zehnten Klasse einen guten Text empfehlen könne. Ich meinte, „Der Nachbar“ oder „Eine kaiserliche Botschaft“ von Franz Kafka seien gute, alt-bewährte Texte, die bei Schülern gut ankommen und mit denen man ihr Textverständnis herausfordern kann. Der Referendar blickte mich etwas verzagt an und meinte dann, der Fachseminarleiter wolle von ihm die Unterrichtsmethode „Lernen an Stationen“ sehen. Zudem sollen die Schüler die Kompetenz „textsortenspezifisches Wissen nutzen“ einüben. Darauf sagte ich ironisch, dann könne er Kafka vergessen. Kafkas Texte ließen sich nicht an Stationen lernen, dazu brauche man einen soliden Bahnhof – also ein gehaltvolles Unterrichtsgespräch.
Geistige Verarmung: Kompetenz verdrängt Inhalt
Was kann man an diesem Beispiel sehen? Es ist modisch geworden, die Methode des Unterrichtens und eine technische Vorgabe – Kompetenz genannt – wichtiger zu nehmen als die Inhalte des Unterrichts. Früher fragte man: „Welcher Text ist für Kinder, die gerade die Pubertät durchlaufen, geeignet, um ihnen ein wenig Orientierung zu geben?“ – Heute fragt man: „Welche Kompetenzen sind im Kompetenzraster noch abzuarbeiten?“ Diese Frage bedingt eine völlig andere Herangehensweise an den Fachunterricht. Die Schulbuchverlage sind inzwischen auf den Kompetenzzug aufgesprungen. In der Pädagogikabteilung von Buchhandlungen stößt man zu Hauf auf Titel wie „Methodentraining“, „Lerntraining“, „Abiturtraining“, „Kompetenzen trainieren“. Man fragt sich, ob man nicht aus Versehen in der Sportabteilung gelandet ist.
Damit Sie diesen didaktischen Irrweg nicht für ein Hirngespinst halten, möchte ich aus dem derzeit gültigen Berliner Rahmenlehrplan für Deutsch für die gymnasiale Oberstufe zitieren. Dort heißt es: „[Es sollen] nicht nur die Systematik des Faches, sondern vor allem (sic) der Beitrag zum Kompetenzerwerb berücksichtigt werden.“ Die Formulierung „vor allem“ gibt der technischen Fertigkeit „Kompetenz“ unübersehbar den Vorrang vor dem Erwerb von Fachwissen – mit fatalen Folgen. Im Literaturunterricht der Gymnasien hat sich inzwischen die Praxis herausgebildet, von vornherein auf die Besprechung schwieriger Texte, etwa der Gedichte von Hölderlin, Rilke, Benn und Ingeborg Bachmann, zu verzichten. Wegen ihrer schwierigen Erschließbarkeit widerstreben sie den „schülerzugewandten Lehrmethoden“ und der „Kompetenzorientierung“. Man muss es sich vergegenwärtigen: Gerade das, was die Qualität unserer klassischen Texte ausmacht, ihre poetische Verrätselung, erweist sich als Hindernis für ihre Behandlung im Unterricht „moderner“ Prägung.
Bei den neu eingeführten Präsentationsprüfungen, die als 5. Prüfungsfach im Abitur gelten, kann man die Fehlentwicklung durch die Kompetenzorientierung ebenfalls studieren. Ich habe Präsentationsprüfungen erlebt, in denen die Schüler in einer Powerpoint-Präsentation den Sachverhalt im elaborierten Sprachduktus flüssig vortrugen. Bei der ersten Verständnisfrage im anschließenden Gespräch gerieten sie dann aber erheblich ins Straucheln. Sie hatten sich die Sätze ihres Vortrags perfekt antrainiert, ohne den Inhalt und die Problematik des Gegenstandes vollständig begriffen zu haben. Der Redefluss (die Kompetenz) hatte sich gegenüber der geistigen Durchdringung des Vorgetragenen (dem Inhalt) verselbständigt. Mir fällt dazu das Postulat Goethes aus seinem Drama „Faust“ ein: „Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, / Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.“ (Faust I, Vers 2565 f.) – Wenn man die Oberfläche – die Technik des Präsentierens – für wichtiger hält als die Substanz – das Verständnis des Gegenstands – , kann man nicht ausschließen, dass die Schüler etwas präsentieren, das sie geistig nicht oder nur halb bewältigt haben. Wie man sieht, setzt sich die im Unterricht praktizierte Vernachlässigung der Inhalte gegenüber den Kompetenzen bis zur Abiturprüfung fort.
Viele Lehrkräfte beklagen inzwischen die inhaltliche Verarmung, die mit der Kompetenzorientierung einhergeht. Auch in der pädagogischen Wissenschaft nimmt die Kritik am Kompetenzbegriff zu. Wissenschaftler kritisieren vor allem den bildungsökonomischen Charakter der Kompetenzen. Es gehe im Unterricht nicht mehr primär darum, das zu lernen, was einen Wert in sich trägt, was also für die geistige Entwicklung Heranwachsender wertvoll und sinnstiftend ist, sondern nur noch das, woraus die Schüler einen praktisch-beruflichen Nutzen ziehen können. Dieser utilitaristische Kompetenzbegriff verhindere – so die Kritiker – das tiefgründige Durchdringen des Unterrichtsgegenstands, was immer die Domäne gymnasialen Lernens gewesen sei.
Der Erwerb von Wissen ist die wichtigste Kompetenz
Zurück zu Wilhelm von Humboldt. Sein Bildungsbegriff geht von der Priorität des Lerninhalts aus. Für ihn müssen Lerngegenstände „idealisch“ sein, sich also einem vorgestellten kulturellen Ideal annähern. Die Gegenstände des Unterrichts sollen die geistigen „Grundkräfte des Menschen“ herausfordern, also das intellektuelle Verständnis entwickeln, die Anschauung und das Gefühl vertiefen und die Einbildungskraft anregen. Humboldt fordert, dass die Lehrkräfte die Lernstoffe danach auswählen, dass sie möglichst viele dieser „Grundkräfte des Menschen“ fördern. Das Verständnis der Welt erschließt sich – so Humboldts Credo – Kindern primär über Wissensinhalte:
„Was also der Mensch notwendig braucht, ist bloß ein Gegenstand, der die Wechselwirkung seiner Empfänglichkeit mit seiner Selbsttätigkeit möglich mache.“
Auch heute gibt es noch viele Bildungswissenschaftler, die dieses Konzept verteidigen, weil sie in ihm die optimale Möglichkeit sehen, jungen Menschen die Welt des Wissens zu erschließen. Der Züricher Pädagogikwissenschaftler Roland Reichenbach insistiert in Rückbesinnung auf den Humboldtschen Bildungsbegriff auf den Primat des Unterrichtstoffes gegenüber den didaktischen Methoden und Kompetenzen: „Eine pädagogische Beziehung definiert sich nicht primär über das sogenannte Interesse am Kind, sondern über die Inhalte, die man ihm vermittelt. Die Abwertung des Wissens ist ein großer Fehler. Die Kinder machen es uns vor. Sie interessieren sich für Dinosauriere oder für Flugzeuge. Das sind Stoffe, keine Kompetenzen.“ („Einspruch“, Zürich, Januar 2016)
Wir können als Pädagogen überhaupt viel von den Kindern lernen. Wer einmal erlebt hat, mit welcher Hingabe und Geduld ein Kind eine Lego-Burg baut, wird begreifen, was es heißt, sich einer Sache völlig hinzugeben. Der Philosoph Wilhelm Schmid sagte einmal: „Das Wichtigste im Leben ist die Erfahrung von Sinn.“ Das spielende Kind verleiht seinem Tun Sinn, indem es sich mit allen Sinnen dem Gegenstand seines Spiels hingibt. Im Unterricht ist es die Aufgabe der Lehrer, die Schüler in die wunderbare Welt des Wissens zu führen und ihnen dadurch die Erfahrung von Sinn zu ermöglichen. Der Schriftsteller Klaus Mann, der Sohn Thomas Manns, sagte einmal, ein guter Lehrer müsse ein „Seelenfänger“ sein. Damit meinte er nicht, der Lehrer solle seine Schüler manipulieren. Nein, er ist der Meinung, dass nur der Lehrer, der für seinen Lerngegenstand brennt, den Geist seiner Schüler entzünden könne. Man braucht nicht eigens zu betonen, dass dabei Formalien wie Lernmethoden oder Kompetenzen eine untergeordnete Rolle spielen. Das Wesentliche sind spannende und aufregende Unterrichtsgegenstände und die Leidenschaft des Lehrers.
Das Humboldtsche Erbe bewahren
Es gibt in Deutschland eine pädagogische Strömung, die das Humboldtsche Bildungsideal am besten aufbewahrt hat: die Reformpädagogik. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Schulen, vor allem sog. Landerziehungsheime, die sich der ganzheitlichen Bildung und Erziehung verschrieben hatten. Das wichtigste Motto der Reformpädagogik ist das „Lernen mit Herz, Kopf und Hand“, wie es Pestalozzi ausgedrückt hat. Neben das kognitive Verstehen (Kopf) tritt die Bildung der Persönlichkeit (Herz) und die Entwicklung der körperlichen, vor allem der manuellen Fähigkeiten (Hand) des Kindes. Die Reformpädagogen wussten, dass nur starke Persönlichkeiten in der Lage sind, im Strudel des Lebens ihren Mann oder ihre Frau zu stehen. Ihr Lieblingswort war deshalb Goethes Lobpreis auf die Persönlichkeit aus seinem Gedichtzyklus „Westöstlicher Diwan“: „Höchstes Glück der Erdenkinder / Sei nur die Persönlichkeit.“- Der Wesenskern der Persönlichkeit sei in jedem Menschen schon von klein an angelegt, er müsse nur durch die helfende und leitende Hand des Pädagogen zum Erblühen gebracht werden. „Werde, der du bist!“ – dieses Wort von Friedrich Nietzsche wurde zum Leitfaden einer Pädagogik, die die Kinder nicht mehr nach den Regeln der Gesellschaft modeln, sondern ihnen den Weg ins Offene, in eine freie Selbstbestimmung zeigen wollten.
In der Didaktik des Unterrichtens gingen die Reformpädagogen völlig neue Wege. Lange galten diese Lehrmethoden als „verschüttet“. Selbst Lehrer wissen oft nicht, dass die didaktischen Konzepte, die sie heute als modern erleben, schon vor 100 Jahren von den Pionieren der Reformpädagogik ersonnen wurden. Das fächerverbindende Lernen verdankt sich der Erkenntnis, dass man am besten lernt im Zusammenhang der Dinge, den die wissenschaftliche Spezialisierung auseinander gerissen hat. Jahrgangsgemischte Lerngruppen erweisen sich als günstig, weil sich jüngere Schüler gerne von älteren belehren lassen und weil die älteren gerne Verantwortung übernehmen. Exkursionen zu fremden Lernorten erweitern den Horizont der Schüler, indem sie dem Lernen im Klassenzimmer eine praktisch-anschauliche Dimension hinzufügen. Projektunterricht dient dazu, den Schülern in einem begrenzten Bereich Eigenverantwortung für den Lernprozess zu übertragen.
Reformpädagogik als Notfall-Medizin
Im Schuljahr 2005/2006 sorgte eine Berliner Hauptschule bundesweit für Furore: die Neuköllner Rütli-Schule, heute eine Gemeinschaftsschule. Sie hatte damals nur noch 267 Schüler, weil bildungsbewusste Eltern ihre Kinder abgemeldet hatten. In einem „Brandbrief“ an den Berliner Bildungssenator verlangten die Lehrkräfte die Schließung der Schule, weil sie der Gewalt durch Schüler nicht mehr standhalten konnten. Dies führte zu einer bundesweiten Debatte über das Schulsystem in Deutschland, über Gewalt an Schulen und die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Nach der Kapitulationserklärung der Lehrer wurde die Pädagogik der Schule radikal umgestellt. Der neue Schulleiter hatte erkannt, dass die Gewaltausbrüche der Schüler aus dem Erlebnis von Schwäche resultieren, aus der Not derer, die sich abgehängt und vernachlässigt fühlen. Deshalb startete die Schule Projekte, die vor allem dazu dienten, die Persönlichkeit der Schüler zu stärken, ihnen Selbstwertgefühl und Ehrgeiz zu vermitteln. Es gab eine Box-AG, die dazu diente, den Schülern über den Sport Regeln und Werte nahe zu bringen. Es gab eine Musik- und Tanz – AG, die mit Hilfe eines professionellen Regisseurs ein Musical einstudierte. Der Erfolg war grandios und wurde allerorten bestaunt. Es gab eine Siebdruckwerkstatt, in der Schüler die T-Shirts mit dem Logo der Schule herstellten. Damit sollte die Identifikation mit der Rütli-Schule und ihrem neuen pädagogischen Geist verstärkt werden. Heute ist die Rütli-Schule eine anerkannte Gemeinschaftsschule, die auch wieder Zuspruch bei bildungsbewussten Eltern findet.
Mir stellt sich die Frage: Warum kommt die Reformpädagogik immer nur dann zum Zuge, wenn ein pädagogischer Notfall eingetreten ist? Warum gehört sie nicht zur selbstverständlichen Grundausstattung jeder Schule, auch unserer Gymnasien? Ich habe über 20 Jahre lang Schultheater unterrichtet und habe von den Kollegen anderer Fächer oft die Rückmeldung bekommen, dass Schüler, die bei der öffentlichen Aufführung eines Stückes auf der Bühne glänzten, auch in ihrem Fach – z.B. in Mathematik, Chemie oder Biologie – wie verwandelt gewesen seien. „Werde der du bist!“ und „Lernen mit Herz, Kopf und Hand“ : Die ganzheitliche Bildung setzt Kräfte frei, die in jedem jungen Menschen schlummern und die eine rein kognitive Ausbildung allein nie entfesseln kann. Deshalb hat Humboldt recht, wenn er fordert: „Griechisch für den Tischler!“
Ausblick und Wunsch
Es wäre wünschenswert, dass sich alle Schulen, auch die Gymnasien, mehr an reformpädagogischen Unterrichtskonzepten orientierten. Damit täten sie nicht nur ihren Schülern etwas Gutes. Sie leisteten auch einen wichtigen Beitrag, das Erbe des großen Bildungsreformers Wilhelm von Humboldt zu bewahren.
Ich schließe mit einem Zitat aus dem Lobgesang des Dichters Clemens Brentano auf die Gründung der „Universität zu Berlin“, 1810, die heute den Namen „Humboldt-Universität zu Berlin“ trägt:
„Der Ganzheit, Allheit, Einheit / Der Allgemeinheit / Gelehrter Weisheit / Des Wissens Freiheit / Gehört dies […] Haus! / So leg ich euch die goldnen Worte aus!“
Ich wünschte mir, dass dieser Lobspruch – so alt-ehrwürdig er ist – den Geist jeder Bildungseinrichtung in unserem Land bestimmte.
(Der Text wurde für diese Veröffentlichung leicht gekürzt.)